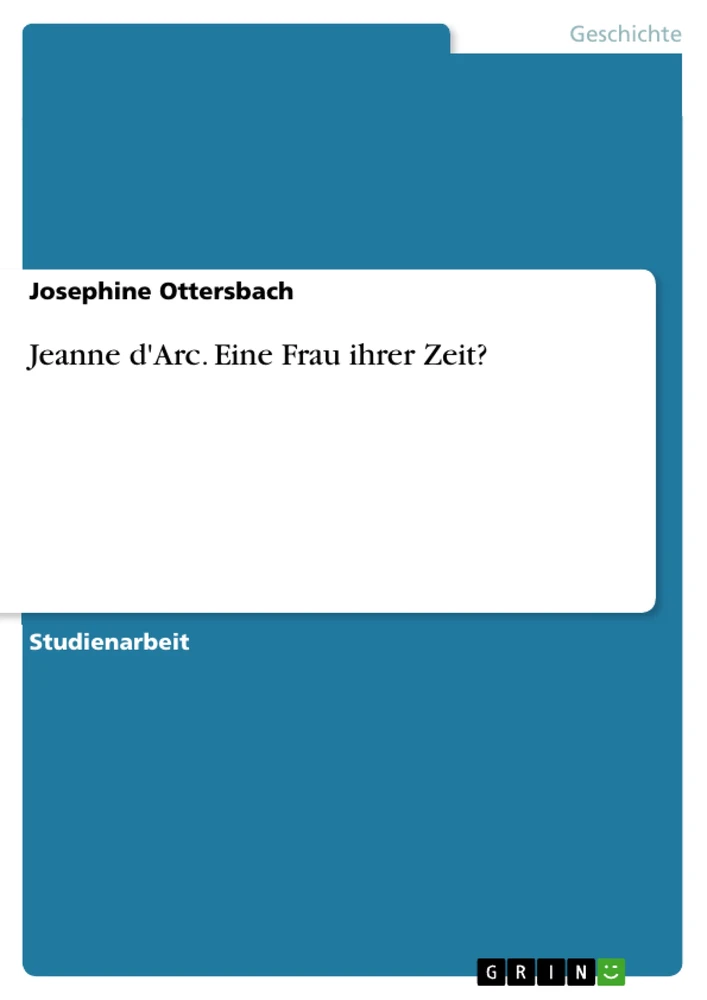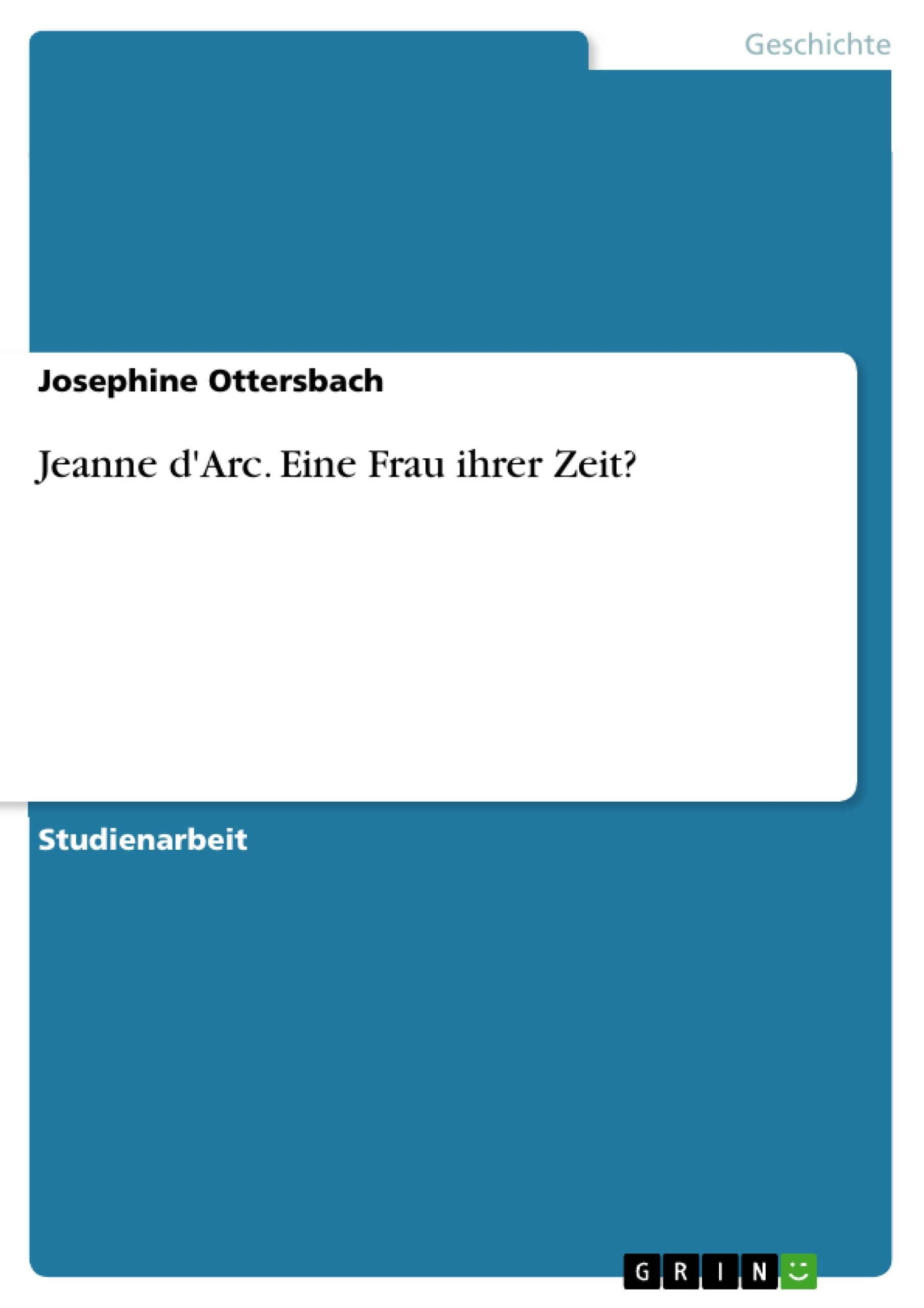Die Hausarbeit ist so aufgebaut, dass sie sowohl einen umfassenden Überblick über das Geschehen vermittelt als auch herausarbeitet, unter welchen Bedingungen Jeanne d'Arcs eigenes Frauenbild entstanden ist. Dazu beginnt die Arbeit mit einer Einführung in den Hundertjährigen Krieg und leitet unmittelbar auf Jeanne d'Arcs Lebensgeschichte über. Anschließend wird das Frauenbild des Mittelalters knapp charakterisiert. Daran schließt sich der Hauptteil der Arbeit an, der der Frage nachgeht, inwiefern Jeanne d'Arc dem Frauenbild dieser Zeit entsprach. Dazu wird Literatur aus der Bibliographie verwendet. Hauptsächlich sind allerdings die Werke von Wolfgang Müller, Gerd Krumeich, Christiane Klapisch-Zuber, Sabine Tanz und Edith Ennen für das Thema einzubinden. Von dieser methodischen Vorgehensweise erhoffe ich mir, dass sich der Leser, durch die Hinführung zum Hauptthema, in die Zeit des Hundertjährigen Krieges hineinversetzen kann und unter diesem und nicht unter heutigem Blickwinkel die Zeit, in der Jeanne d'Arc lebte, betrachten wird. Des Weiteren erhoffe ich mir davon, dass eine bessere, klarere und vor allem verständnisvolle Auslegung Jeanne d'Arcs Denkens und Handelns ermöglicht wird. Darüber hinaus soll ein objektiver, aber dennoch standortgebundener Rahmen zur Ermittlung Jeanne d'Arcs Frauenbilds erstellt werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Geschichtliche Einordnung
3 Jeanne d'Arc
3.1 Ein Bauernmädchen aus Domrémy
3.2 Aufstieg und Gefangennahme
3.3 Der Inquisitionsprozess vonRouen
4 Das Frauenbild im 14. und 15. Jahrhundert
5 Das Frauenbild des 14. und 15. Jahrhunderts im Vergleich mitJeanne d'Arc
6 Auswertung
7 Bibliographie