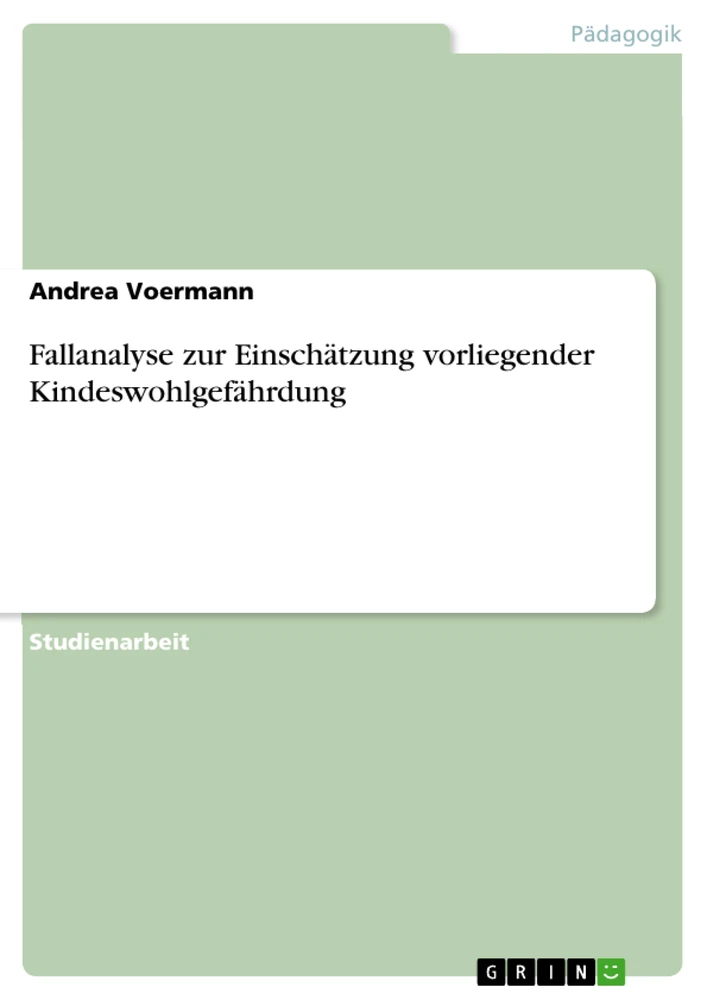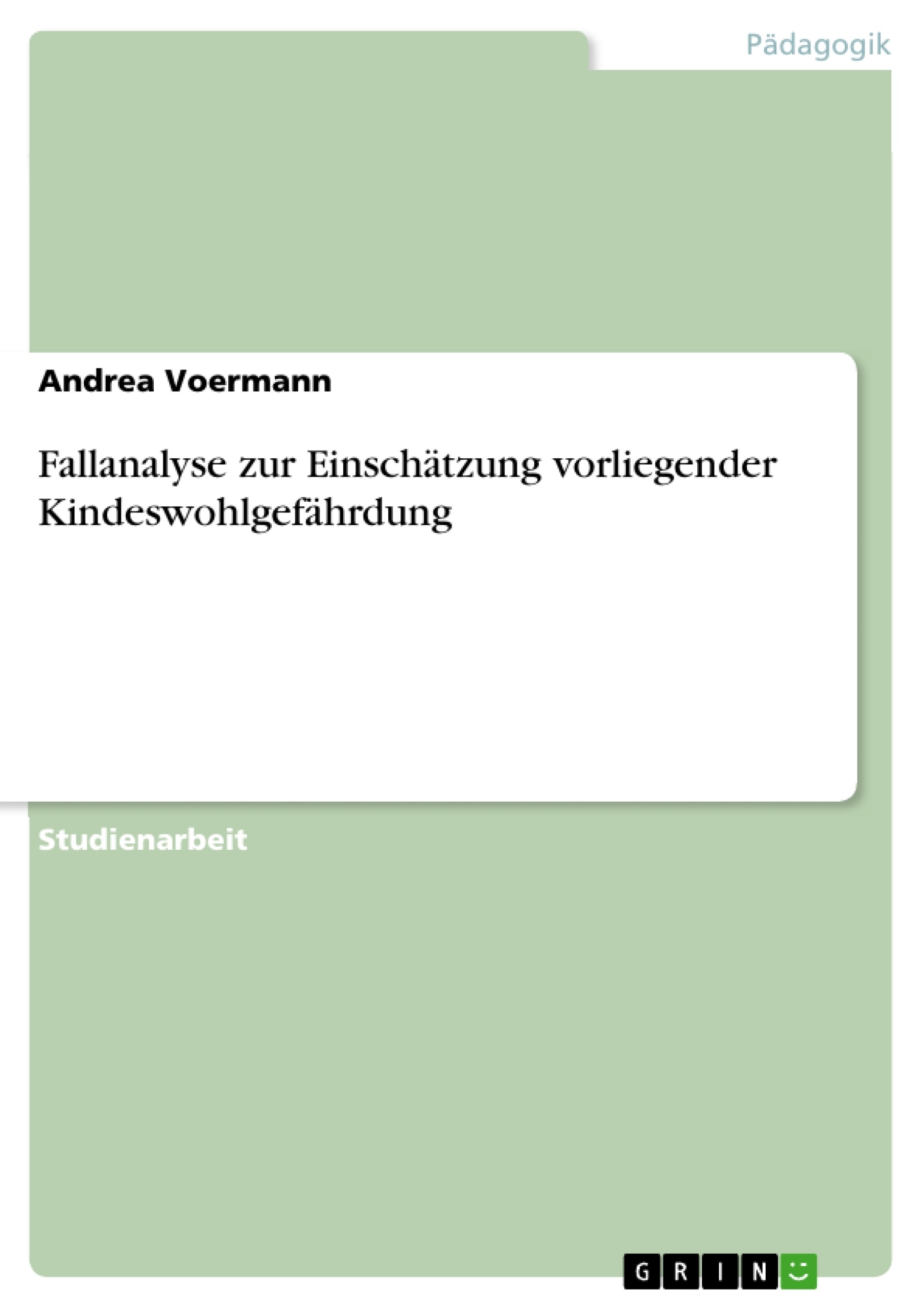In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit dem Thema "Kindeswohlgefährdung". Anhand eines Fallbeispiels bearbeite ich exemplarisch das Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung aufgrund rechtlicher Grundlagen. Dazu schildere ich den Sachverhalt um eine Fallfrage ableiten zu können. Anhand der Subsumtionsmethode werde ich die Fallfrage bearbeiten und zu einer Lösung kommen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kindeswohl und Kinderschutz
2.1. Definition
2.2. Inhalt des § 1666, BGB
2.3. Inhalt des § 8a, KKG
2.4. Inhalt des § 8a, SGB VIII
2.5. Kinderrechte UN-Konvention
3. Aspekte von Kindeswohlgefährdung
3.1. Indikatoren bei einer Kindeswohlgefährdung
4. Fallbearbeitung
4.1. Sachverhalt
4.2. Fallfrage
4.3. Lösungsweg
4.4. Beantwortung der Fallfrage
5. Resümee
6. Literaturverzeichnis