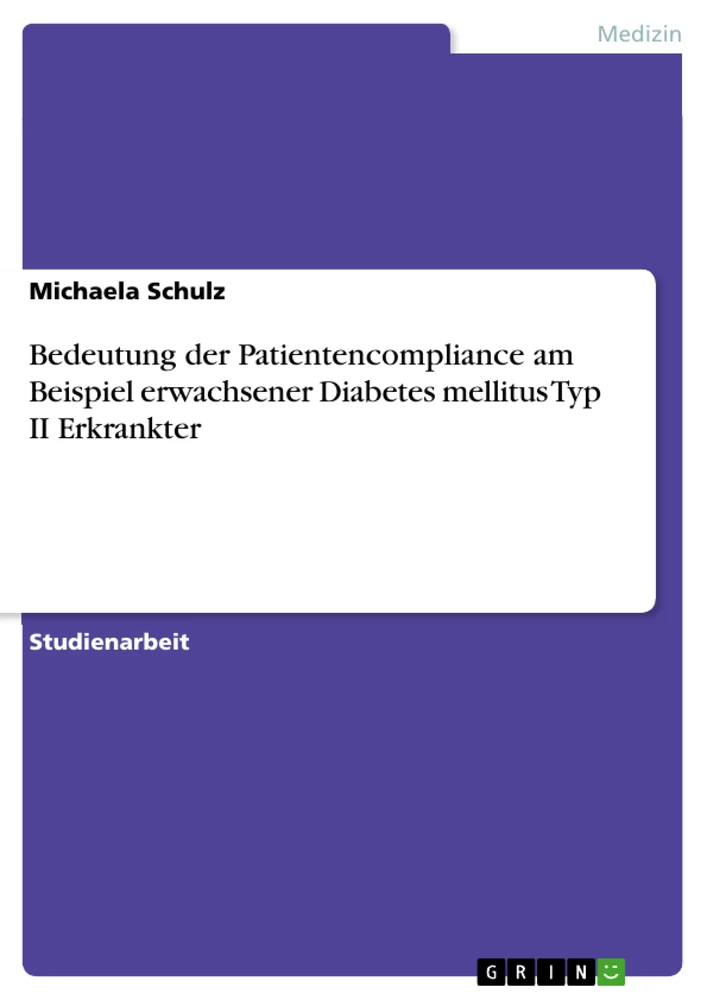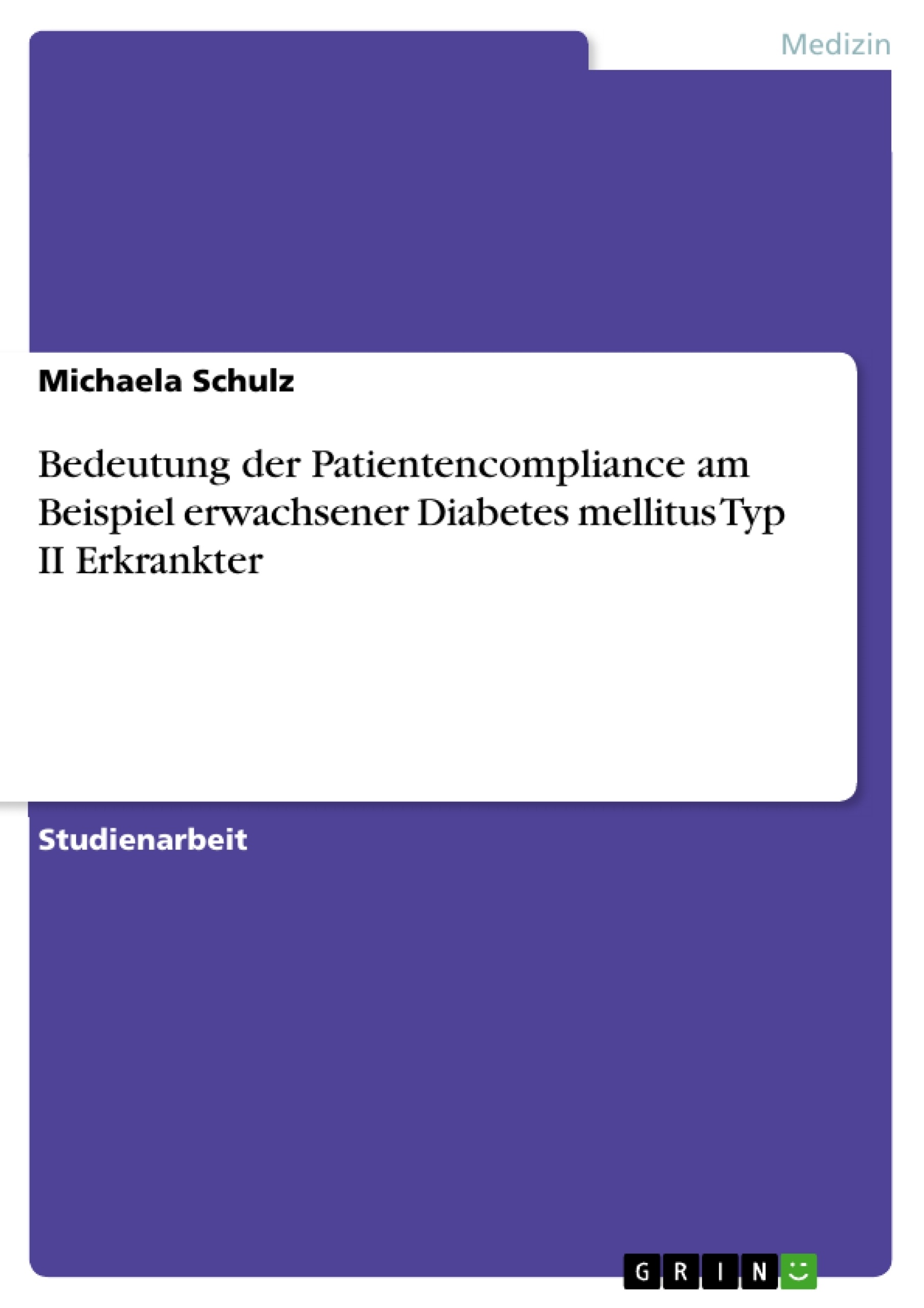Im Bezug auf den Erfolg der Behandlung des Diabetes mellitus ist die Patientencompliance, also die Bereitschaft der Patienten zur eigenen Mitarbeit und zum gemeinsamen Agieren mit dem Arzt, ein wichtiger Aspekt. Eine Non-Compliance hat direkte Auswirkungen auf den Therapieerfolg, aber auch auf die zunehmend angespannte Kostensituation des gesamten Gesundheitssystems.
Ziel der Hausarbeit ist es, die Compliance an Diabetes mellitus Typ II erkrankten Erwachsenen zu untersuchen, ihre Bedeutung aufzuzeigen und Möglichkeiten zur Steigerung der Compliance abzuleiten.
Dabei soll im Rahmen der Hausarbeit folgende konkrete Forschungsfrage beantwortet werden: Wie kann die Compliance der an Diabetes mellitus Typ II erkrankten Erwachsenen erhöht werden?
Inhaltsverzeichnis
I Abkürzungsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
III Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Compliance und Non-Compliance
2.1.1 Formen der Compliance und Non-Compliance
2.1.2 Methoden zur Messbarkeit der Compliance
2.1.3 Determinanten der Compliance
2.1.4 Auswirkungen mangelnder Compliance
2.2 Diabetes mellitus Typ II
2.2.1 Krankheitsbild und Folgeerkrankungen
2.2.2 Epidemiologie und gesundheitsökonomische Bedeutung
2.2.3 Therapiemöglichkeiten
3 Methodisches Vorgehen
4 Compliance bei Diabetes mellitus Typ II
4.1 Ausmaß der Compliance bzw. Non-Compliance bei Diabetes mellitus
4.2 Determinanten der Compliance bei Diabetes mellitus
4.3 Möglichkeiten zur Verbesserung der Compliance bei erwachsenen Diabetes mellitus Erkrankten
5 Kritische Reflexion der Ergebnisse
6 Zusammenfassung
7 Literatur-/Quellennachweis
8 Ehrenwörtliche Erklärung