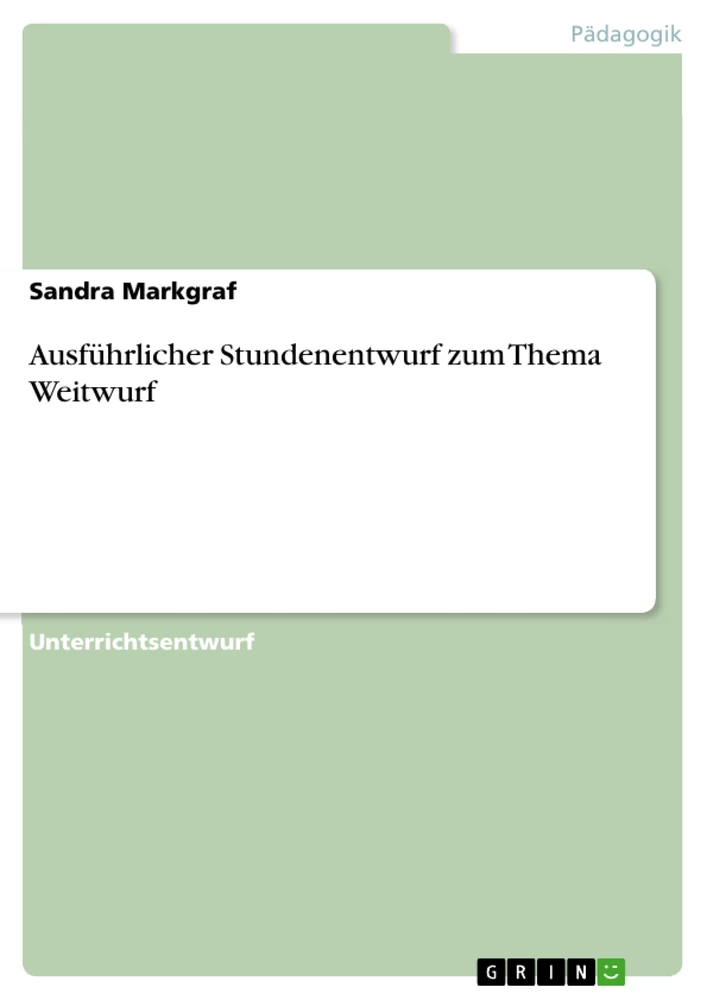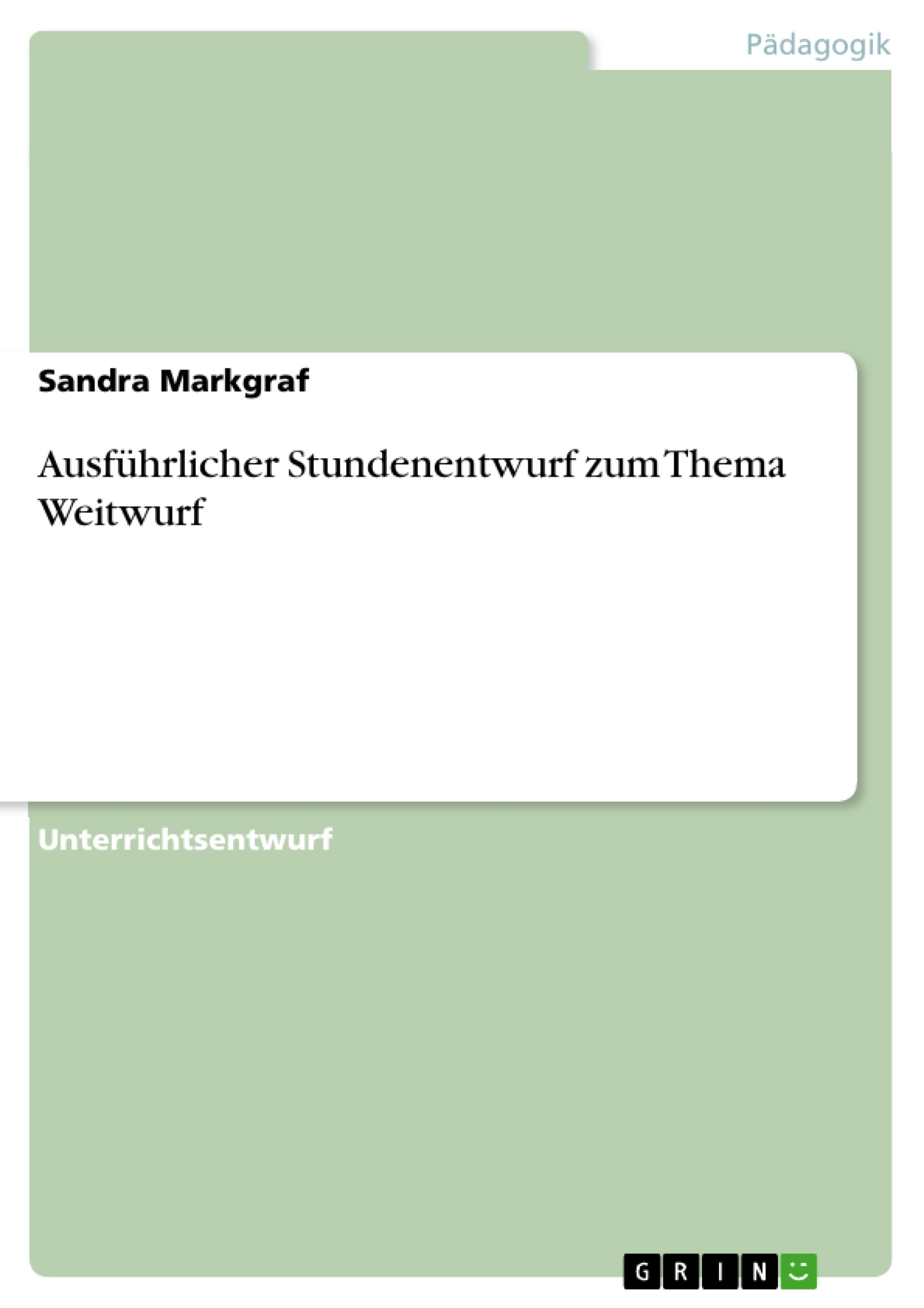Werfen gehört neben Laufen und Springen zu den grundlegenden Bewegungsformen des Menschen. Dennoch gibt es einen großen Unterschied zwischen ihnen: Laufen und Springen zielen darauf ab, sich selbst zu bewegen, während beim Werfen weniger der eigene Körper als vielmehr ein Gegenstand auf eine möglichst effektive Art und Weise bewegt wird. Dies passiert vor allem durch den Einsatz der Arm- und Oberkörpermuskulatur; außerdem muss je nach Form, Gewicht und Flugeigenschaften des Gegenstandes der richtige Bewegungsablauf gewählt und umgesetzt werden. Unterschieden wird zwischen geradlinigen Würfen (z.B. Sprungwurf im Handball, Speerwurf oder Schlagballwurf), Stoßen und Drehwürfen (z.B. Diskus, Schleuderball und Hammerwurf) - alles sind einhändige Würfe. Daneben gibt es auch beidhändige Würfe (z.B. Druckpass im Basketball). Da der Schlagwurf die Grundlage für alle anderen Würfe darstellt, sollte die Technik mit ausreichend Zeit eingeführt und ausführlich geübt werden.
Inhalt
1 Bedingungsanalyse
1.1 Situation der Klasse
1.2 Lernvoraussetzungen
1.3 Innerschulische Voraussetzungen
2 Sachanalyse
3 Kompetenzerwerb/Stundenziel
4 Didaktische Reflexion
4.1 Bezug zum Bildungsplan
4.2 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung
4.3 Bezug der Schülerinnen
4.4 Stellung der Stunde
4.5 Didaktische Reduktion
4.6 Schwierigkeitsanalyse
4.7 Didaktische Prinzipien
5 Methodische Reflexion
5.1 Aufwärmen
5.2 Hauptteil
5.3 Schluss
5.4 Alternative zum Ausstieg oder zum Fortführen
6 Verlaufsplan
7 Literatur
7.1 Internetquellen
7.2 Bücher