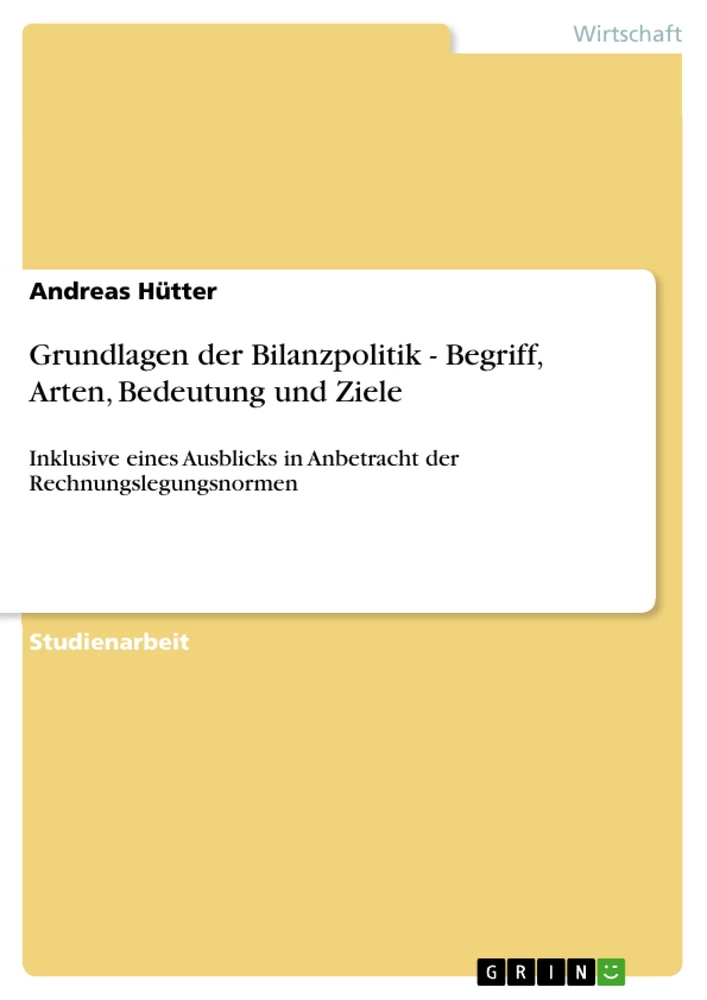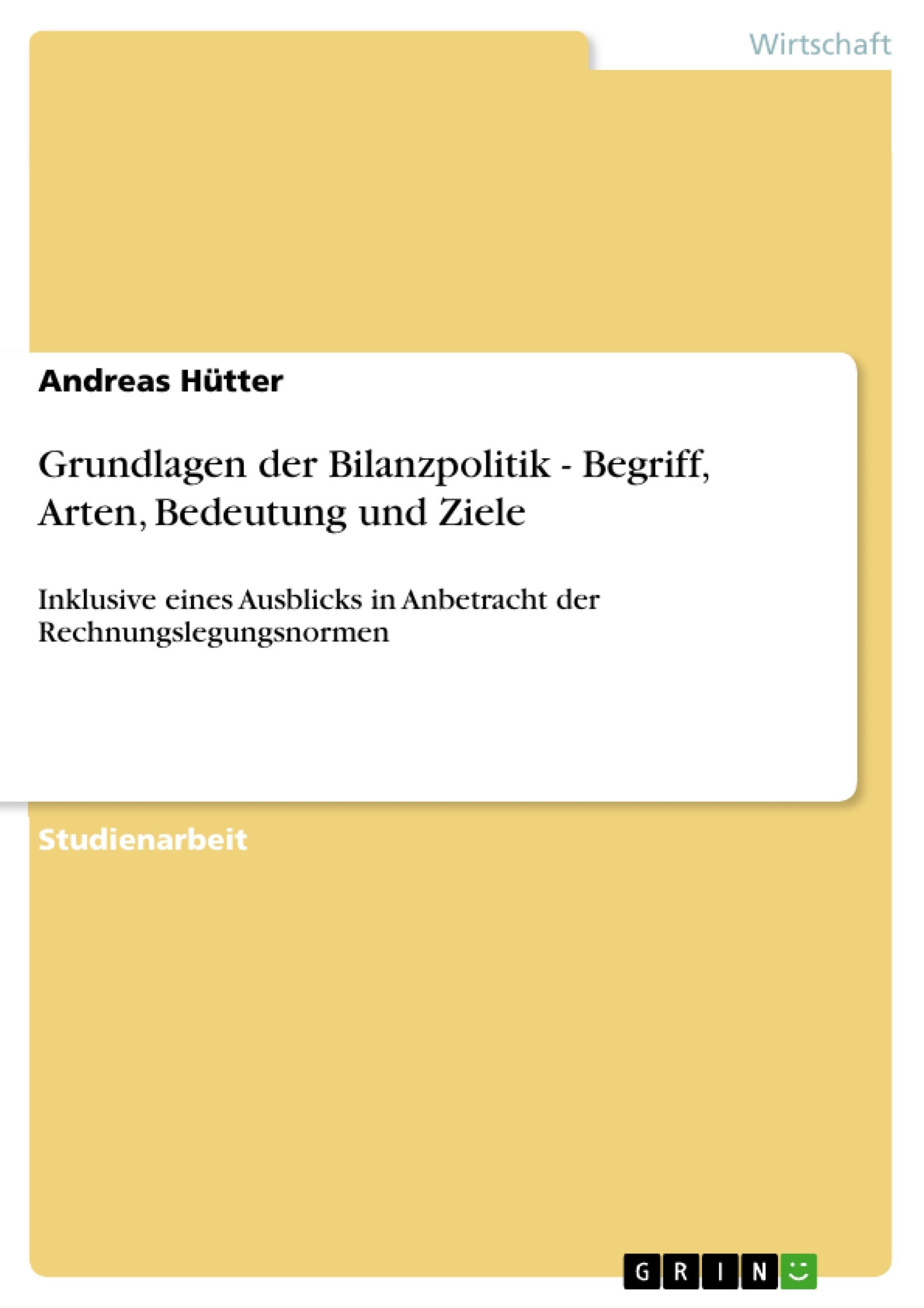„Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass man mit Bilanzen so ziemlich alles machen kann, die Commerzbank hat ihn nun geliefert. Sie meldet für 2011 sowohl einen Gewinn von 638 Millionen Euro als auch einen Verlust von 3,6 Milliarden Euro – was stimmt denn nun? Beides. Alles eine Frage der Methode. Der Gewinn steht unter dem Strich jener Bilanz, die die Bank nach den internationalen Bilanzierungsvorschriften IFRS aufgestellt hat. Der Multimilliardenverlust ergibt sich in einer zweiten Bilanz nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB).“ Gründe für diese Bilanzgestaltungen können zum einen die Koppelung der zu zahlenden Zinsen an das Ergebnis nach HGB sein. Hierbei muss die Commerzbank für die Inanspruchnahmen staatlicher Hilfen nur Zinsen zahlen wenn Gewinn erwirtschaftet wird. Zum anderen plant der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Martin Blessing, eine Kapitalerhöhung und möchte in diesem Zusammenhang im internationalen Licht, nach IFRS, gut dastehen. „Schöner kann man es gar nicht zeigen, wie man … Bilanzpolitik machen kann.“
Man erkennt, dass Bilanzpolitik dem Unternehmen gewisse Freiheiten und Möglichkeiten gewährt. Im Rahmen der vorliegenden Seminararbeit soll ein grundlegender und wissenschaftlich basierter Überblick des Themenbereichs Bilanzpolitik gegeben werden. Dabei wird im folgenden Kapitel erläutert, was unter dem Begriff der Bilanzpolitik zu verstehen ist und woraus er abgeleitet wurde. Im darauf folgenden Kapitel wird beschrieben warum Bilanzpolitik betrieben wird und welche Bedeutung ihr zuzurechnen ist. Des Weiteren werden in diesem Kapitel kurz die bilanzpolitischen Ziele und mögliche Zielkonflikte zusammengefasst. In Kapitel vier erfolgt ein systematischer Überblick der Arten bilanzpolitischer Instrumente und ihre Wirkungsweise. Zum Abschluss dieser Arbeit folgt ein Fazit mit den wesentlichen Erkenntnissen und einem Ausblick bezogen auf die Wahl der Rechnungslegungsnorm und die Änderungen für die Bilanzpolitik durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
1 Aktueller Bezug und Abgrenzung der Thematik
2 Der Begriff der Bilanzpolitik
3 Bedeutung und Ziele
4 Arten bilanzpolitischer Instrumente
4.1 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen
4.2 Sachverhaltsabbildende Maßnahmen
4.2.1 Materielle bilanzpolitische Instrumente
4.2.2 Formelle bilanzpolitische Instrumente
5 Fazit und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Elektronische Quellen
Quellenverzeichnis