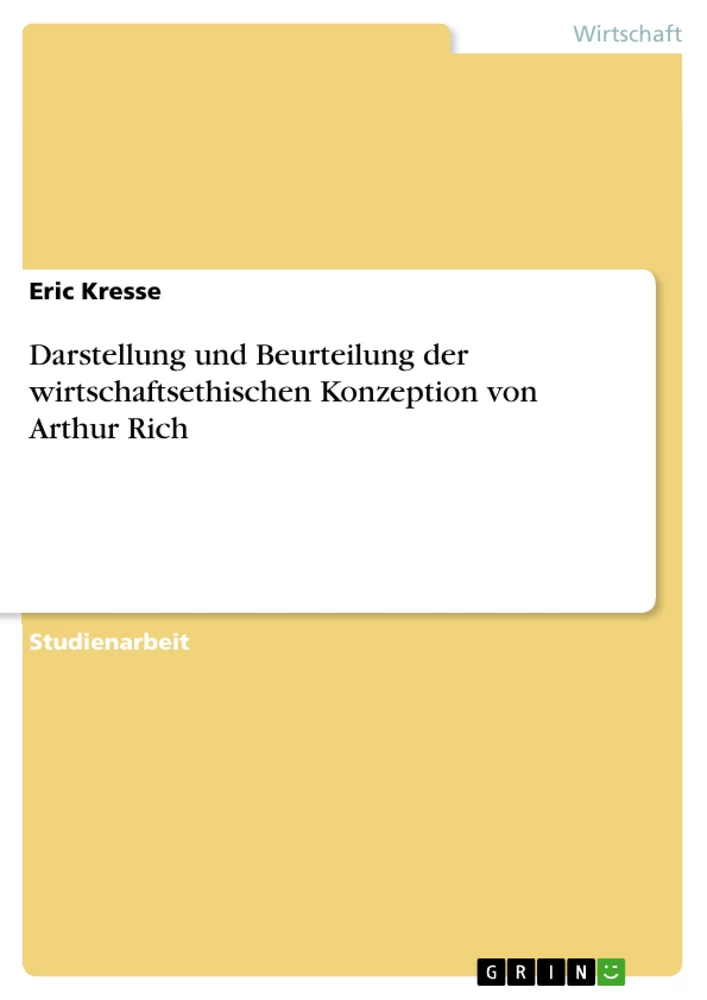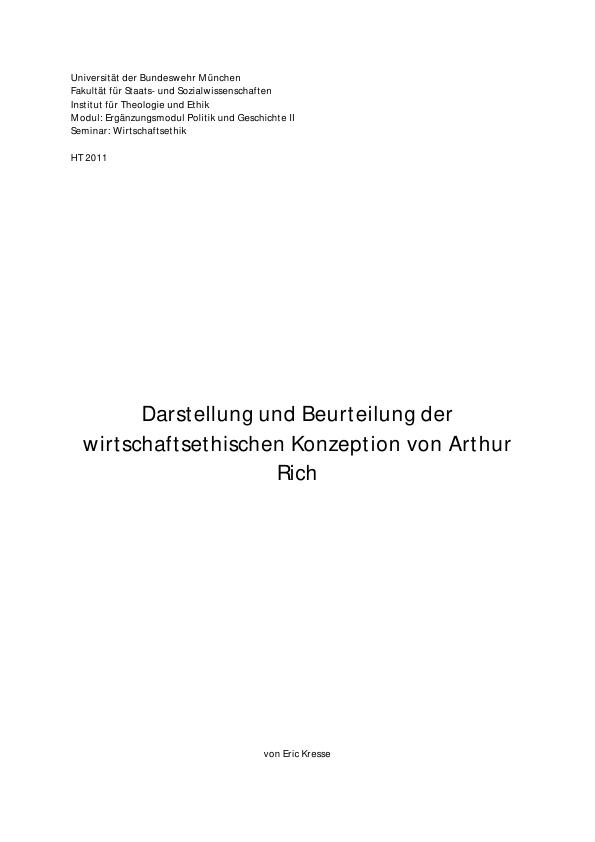Diente Geld früher dazu, Waren und Dienstleistungen zu finanzieren, so scheint es heute vor
allem zu existieren, um neues Geld zu schaffen. Derivate, Devisen, Rohstoffhandel,
Leerverkäufe, EZB, EFSF, IWF, Rettungsschirm und Hebel bilden dabei nur einige Begriffe, die
von Nicht-Bankern kaum noch zu überschauen sind und daher mangels Verständnis auch
kein Vertrauen erzeugen. [...] In diesem
Zusammenhang hat der Schweizer Arthur Rich, für den der christliche Glaube essentiell im
Zentrum wirtschaftlichen Geschehens steht, bereits 1984 eine „Wirtschaftsethik“
veröffentlicht, in welcher er Theologie, Sozialethik und Wirtschaftsordnung systematisch in
Beziehung setzt und folglich Instanzen zur Gewinnung ethischer Urteils- und
Handlungskompetenzen entwickelt. Die vorliegende Arbeit hat das Interesse, die
wirtschaftsethische Konzeption Richs darzustellen und zu prüfen, ob es dem Autor gelingt,
Möglichkeiten einer besseren Gestaltung des menschlichen Lebens in wirtschaftlicher
Perspektive aufzuzeigen. Dabei wird zunächst die für seine Arbeit bedeutende Biographie
Richs nachgezeichnet, woran sich eine systematische Rekonstruktion der Grundgedanken
des Autors anschließt. Sowohl in diesem Kapitel, als auch in der sich anschließenden
Beurteilung des Werkes, basierend auf dem Verständnis des guten Lebens des Autors dieser
vorliegenden Arbeit, wird darüber hinaus Bezug auf Susanne Edels „Wirtschaftsethik im Dialog“ genommen, da dieses Werk das Rich`sche Konstrukt treffend nachzeichnet und
darüber hinaus gelungen interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Biographie des Arthur Rich
3. Darstellender Teil: Richs Grundlagen der „Wirtschaftsethik“
3.1. Sozialethik im Kontext der Sozialwissenschaften
3.2. Kriterien des Menschengerechten
3.2.1. Kriterium der Geschöpflichkeit
3.2.2. Kriterium der kritischen Distanz
3.2.3. Kriterium der relativen Rezeption
3.2.4. Kriterium der Relationalität
3.2.5. Kriterium der Mitmenschlichkeit
3.2.6. Kriterium der Mitgeschöpflichkeit
3.2.7. Kriterium der Partizipation
3.3. Ertragssicherung
4. Beurteilender Teil
4.1. Beurteilung der Überlegungen Richs zur Wirtschaftsethik
4.2. Ertragssicherung
5. Zusammenfassung
6. Bibliographie
6.1. Literaturverzeichnis
6.2. Quellenverzeichnis