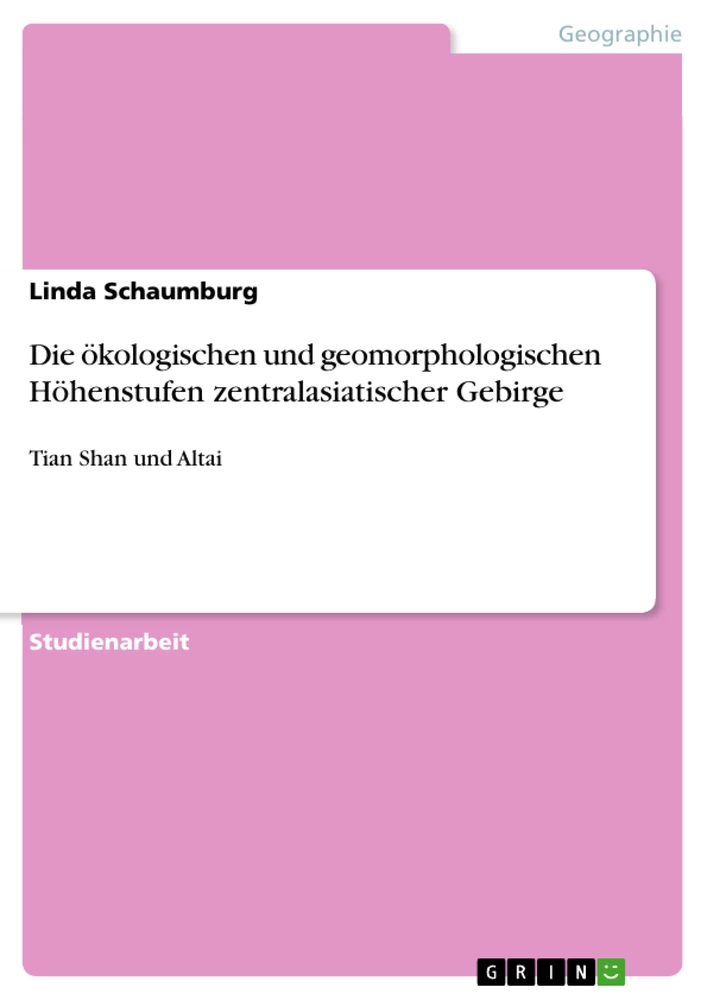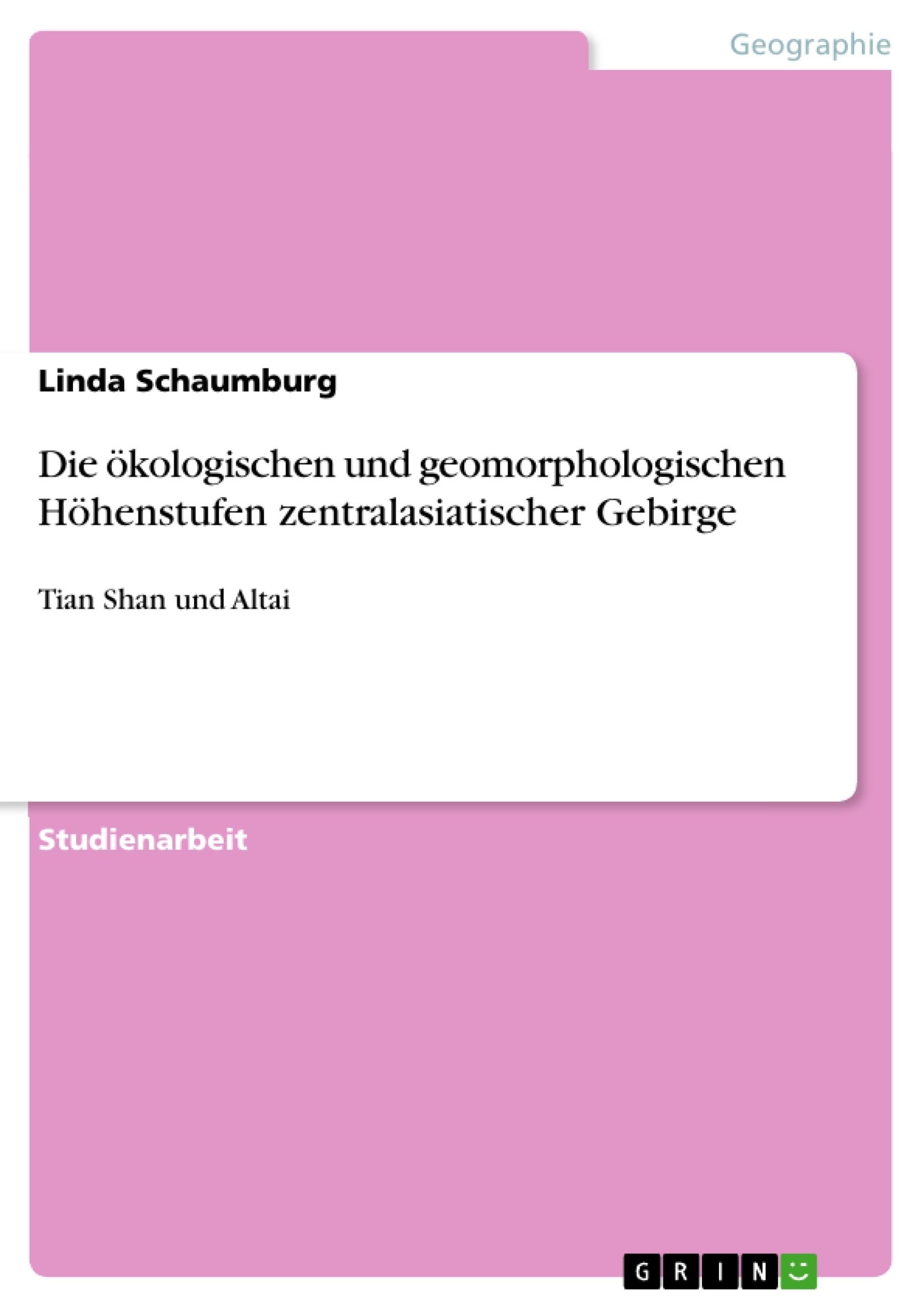Im nordwestlichen Teil Zentralasiens erhebt sich ein System von Hochgebirgen, deren Ketten meistens von Ost nach West streichen. Neben dem Altai unterscheidet man noch drei weitere Hochgebirge, den Tian Shan, den Alai und den Pamir (SUCCOW 1989: 187). In der vorliegenden Hausarbeit beschäftige ich mich gemäß dem Thema ausschließlich mit dem Tian Shan und dem Altai. In erster Linie geht es dabei um die Höhenstufen der Vegetation. Laut MIEHE, BURGA & KLÖTZLI (2004: 31) zeigen Vegetationshöhenstufen ihre eigenen individuellen Vegetations-Typen, Wuchsformen und Lebensstrategien von Pflanzen, denen ein spezifischer Wärme- und Wasserhaushalt zukommt und die in einem Grenzgürtel (Ökoton) von einigen Dutzend Höhenmetern ineinander übergehen. Je nach den Eigenheiten der Oberflächenformen und der Lage in den Gebirgen sind Exposition und Hangneigung mitprägend. Die heute gebräuchliche Benennung der Höhenstufen lehnt sich an die humiden alpinen Bedingungen Mitteleuropas an und wird gewöhnlich in die kolline, montane, subalpine und alpine Stufen eingeteilt (MIEHE, BURGA & KLÖTZLI 2004: 32).
Inhalt
1. Einleitung
2. Untersuchungsgebiete
2.1 Lage und Größe
2.2 Geologie
2.3 Klima
2.4 Tierreich
3. Rezente ökologische Höhenstufen
3.1 Übersicht
3.2 Kolline Stufe
3.3 Montane Stufe
3.4 Subalpine Stufe
3.5 Alpine Stufe
4. Verschiebung der (geomorphologischen) Höhenstufen
4.1 Rezente Höhenstufen
4.2 Vergleich zu den Kaltzeiten
Literaturverzeichnis
Weiterführende Literatur