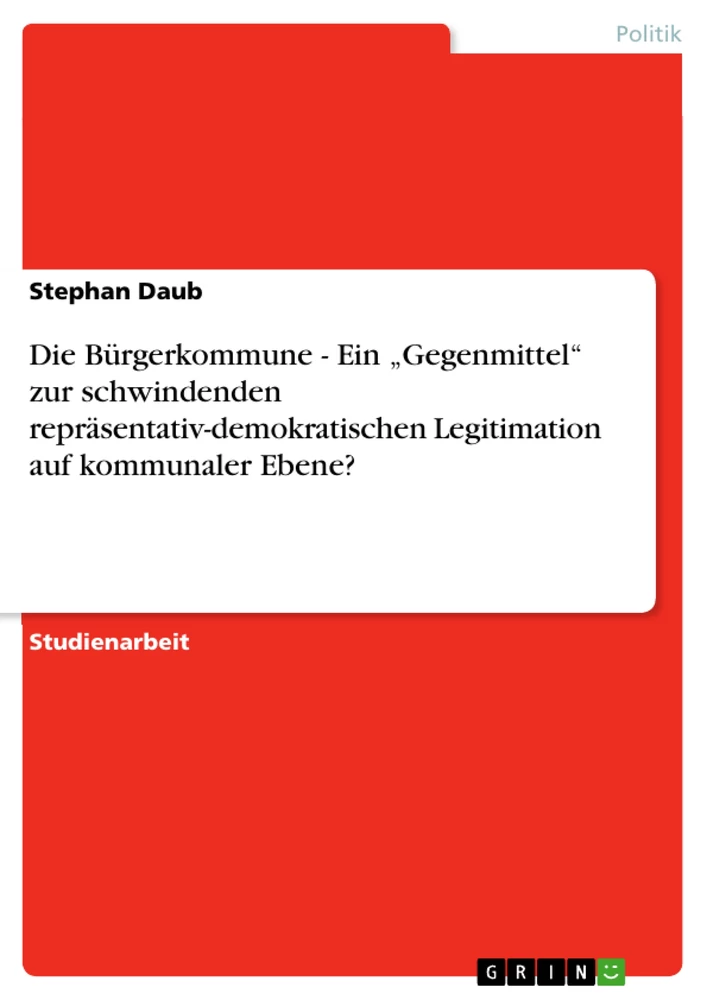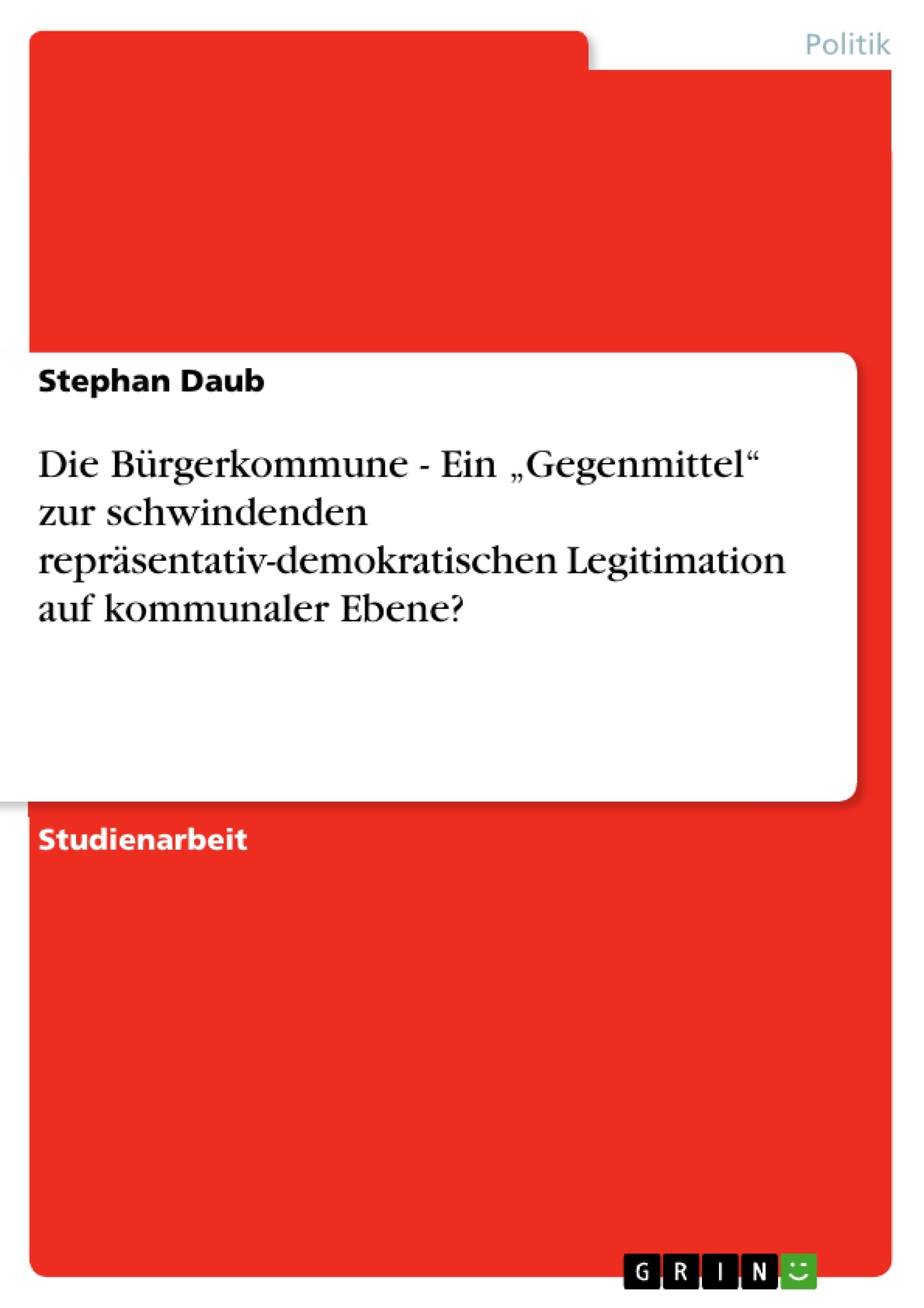„Demokratie ist die Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk!“. Diese Behauptung des ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln ist im Großen und Ganzen wohl richtig. Bei näherer Betrachtung und einem Vergleich zum repräsentativen Demokratieverständnis wird allerdings deutlich, dass die letztendliche Entscheidungsgewalt bei der politischen Elite liegt, die durch das Volk gewählt wurde. Aber wodurch legitimieren sich in der heutigen Zeit noch diese Entscheidungen auf der kommunalen Ebene? In Zeiten sinkender Wahlbeteiligung, Politikverdrossenheit und der wachsenden Finanznot vieler Kommunen ist dies eine berechtigte Frage. Zudem klaffen die Interessen der Auftraggeber (Bürgerinnen und Bürger) und die Interessen der Mandatsträger weit auseinander. Entscheidungen der Politiker stoßen vermehrt auf Widerstände bei den Bürgern, da sie von diesen nicht als legitim empfunden werden (Bsp. ,Stuttgart 21‘).
In den vergangenen Jahren wird der Ruf einer ,Bürgerkommune‘ immer lauter. Demnach sollen die Bürgerinnen und Bürger aktiv mit in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Politikwissenschaftler versprechen sich hierdurch eine höhere Akzeptanz und Effektivität, der auf kommunaler Ebene gefällten (politischen) Entscheidungen.
Kann man die Bürgerkommune als ,Gegenmittel‘ zur schwindenden repräsentativ-demokratischen Legitimation auf kommunaler Ebene ansehen?
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Bürgerkommune: Schnittstelle von repräsentativer, direkter und kooperativer Demokratie
3. Die Bürgerkommune
3.1. Was ist die Bürgerkommune? Begriffsdefinitionen
3.2. Die veränderte Bürgerrolle und das Leitbild der Bürgerkommune
4. Die Bürgerkommune in der Praxis: Beteiligungsmöglichkeiten an Planungs- und Entscheidungsprozessen
4.1. Der Bürgerhaushalt
5. Die Bürgerkommune in der Praxis: Förderungsmöglichkeiten des freiwilligen Engagements
5.1. Spielplatzpatenschaften
6. Schlussbetrachtung
7. Literaturverzeichnis
8. Gegen die Herabsetzung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahren bei kommunalen Wahlen. Eine Argumentation gegen den jüngsten Vorschlag der Saarliberalen, auch Jugendlichen eine Stimme geben zu wollen.