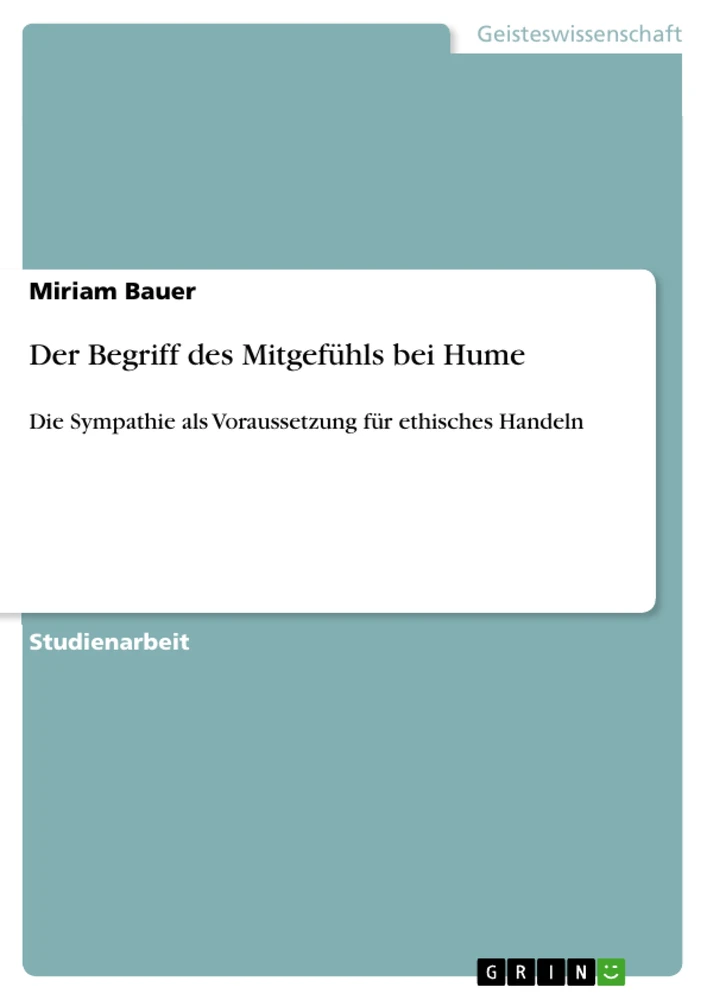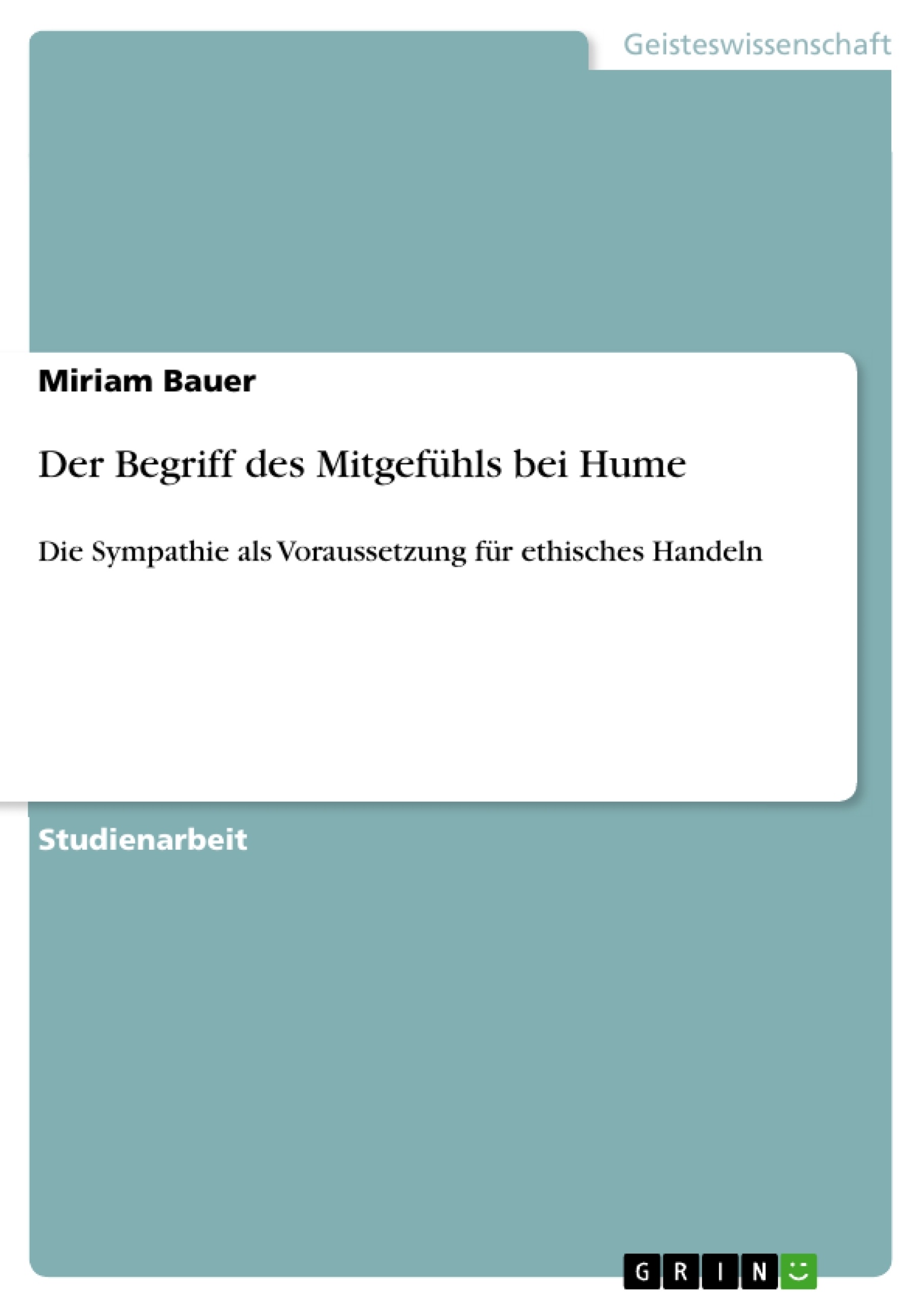Nach Humes Ansicht wird unser menschliches Verhalten nicht durch die Vernunft gesteuert, sondern durch Affekte und Gefühle. Dabei basiert seine Moralphilosophie auf zwei Prinzipien der subjektiven Empfindungen: Selbstliebe und Sympathie (Mitgefühl). Das diese beiden Begriffe sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern sogar bedingen, zeigt Hume im Buch III seines Werkes "Ein Traktat über die menschliche Natur" auf. Der Autor sieht in Mitgefühl die Quelle aller Wertschätzung und die Basis zur Entwicklung von Gefühlen, die für die Moral entscheidend sind.
Die Hausarbeit untersucht den Begriff des Mitgefühls als moralische Instanz bei Hume. Als Gegengewicht zur Humes Sympathieethik fließt die Kritik von Max Scheler mit ein.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Begriffsklärung: Affekte
1.2 Begriffsklärung: Mitgefühl
2. Mitgefühl als Basis von moralischen Gefühlen
2.1 Mitgefühl als gesellschaftlicher Vorteil
2.2 Mitleid – Mitgefühl
2.3. Unterscheidung von Fremden und Nahestehenden
2.4 Sympathie bei Tieren
3. Schelers Kritik an der Sympathieethik
4. Fazit: Die Sympathie als Voraussetzun für moralisches Handeln
5. Literaturverzeichnis