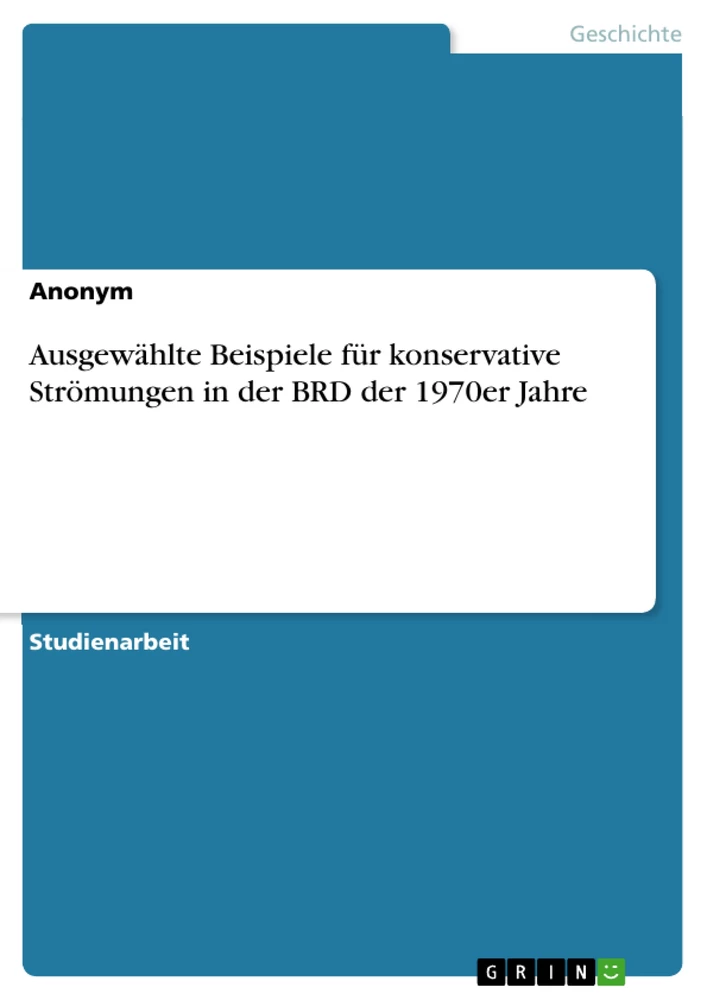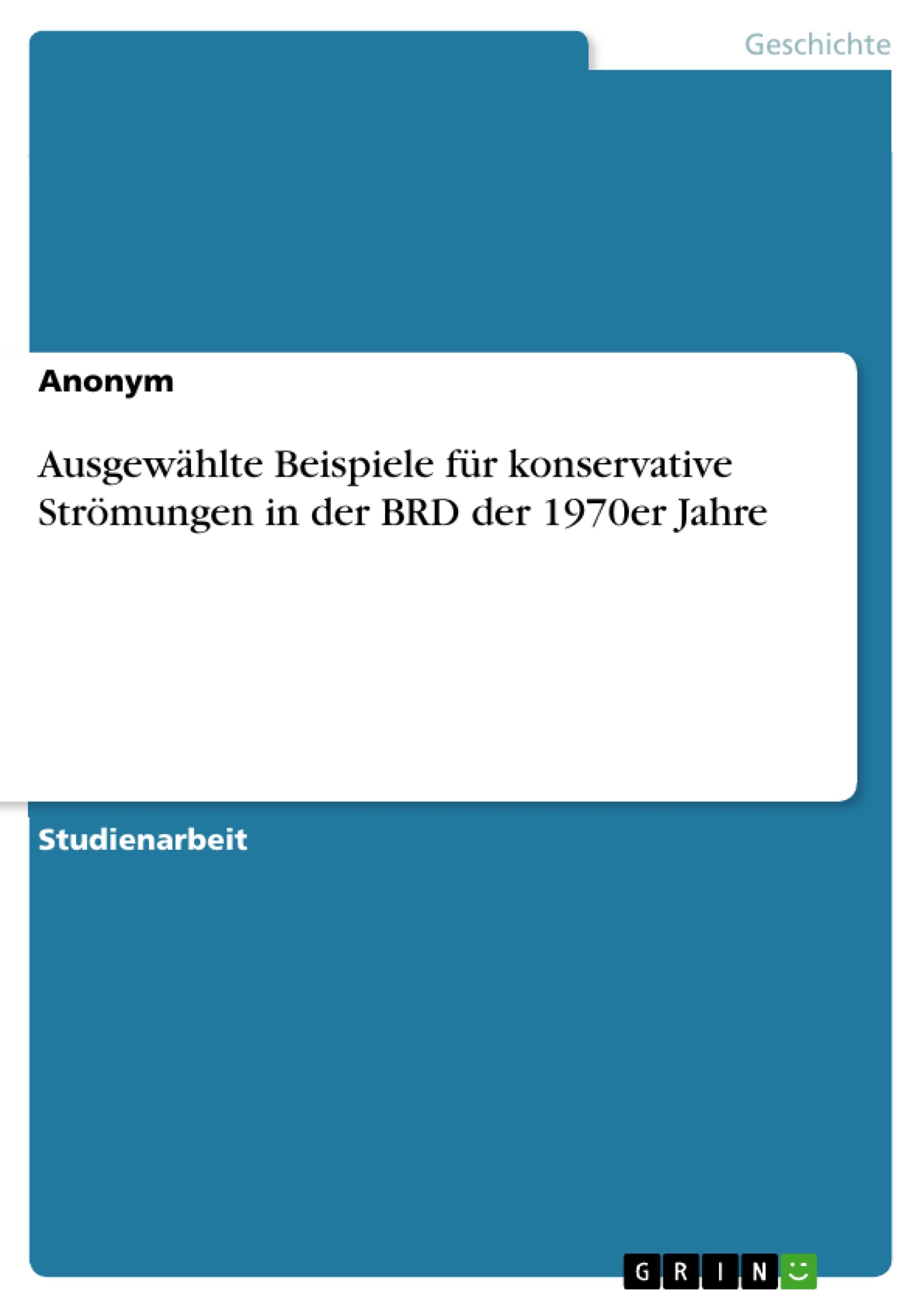Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 3
2. Konservatismus – Zur Definition und seiner Erscheinung in CDU/CSU 5
2.1. Konservativ oder reaktionär?
2.2. Die CDU/CSU in der Opposition 6
2.2.1. Erste Reaktionen 8
2.2.2. Kurze Darstellung der Ostpolitik
2.2.3. Widerstand gegen die neue Ostpolitik seitens der CDU/CSU 9
3. Konservatismus in der evangelischen und der katholischen Kirche 12
3.1. Christlicher Konservatismus
3.2. Die evangelische Kirche 13
3.3. Die katholische Kirche und der Katholizismus 14
4. Der Konflikt um §218 und die „Lebensrechtler“ 16
4.1. Kurze Darstellung der Abtreibungs-Problematik
4.2. Die „Lebensrechtler“ als Beispiel einer konservativen Bewegung
4.2.1. Verbände und Organisationen
4.2.2. Wertvorstellungen
4.2.3. Strategien der Einflussnahme
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Konservatismus – Zur Definition und seiner Erscheinung in CDU/CSU
2.1. Konservativ oder reaktionär?
2.2. Die CDU/CSU in der Opposition
2.2.1. Erste Reaktionen
2.2.2. Kurze Darstellung der Ostpolitik
2.2.3. Widerstand gegen die neue Ostpolitik seitens der CDU/CSU
3. Konservatismus in der evangelischen und der katholischen Kirche
3.1. Christlicher Konservatismus
3.2. Die evangelische Kirche
3.3. Die katholische Kirche und der Katholizismus
4. Der Konflikt um §218 und die „Lebensrechtler“
4.1. Kurze Darstellung der Abtreibungs-Problematik
4.2. Die „Lebensrechtler“ als Beispiel einer konservativen Bewegung
4.2.1. Verbände und Organisationen
4.2.2. Wertvorstellungen
4.2.3. Strategien der Einflussnahme
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis