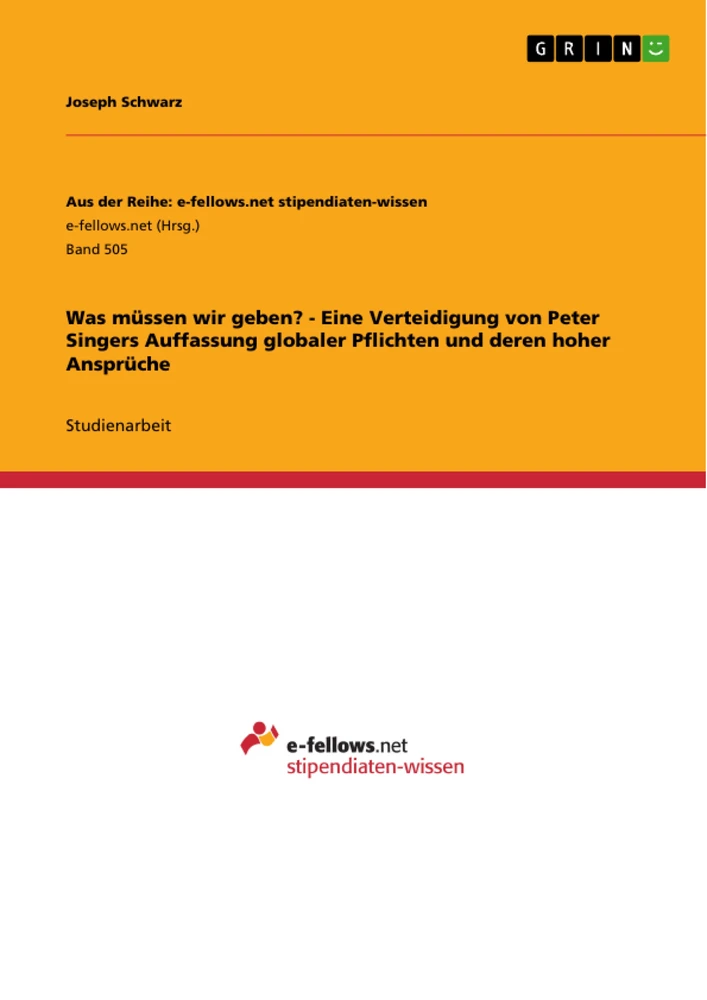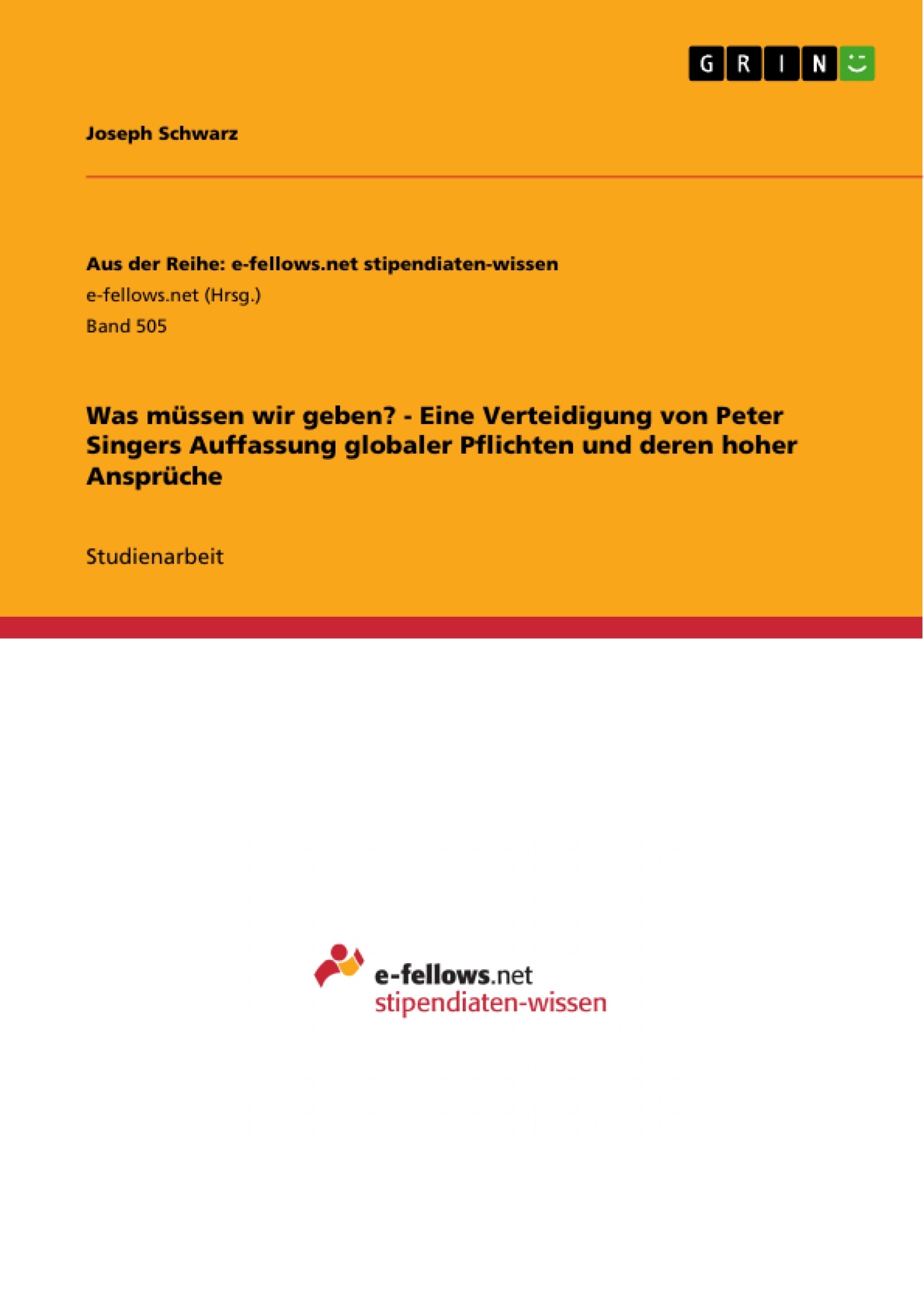Die folgende Arbeit beschäftigt sich Peter Singers radikalem Verständnis von individuellen Hilfspflichten der westlichen Welt gegenüber global notleidenden Menschen. Diese sind so weitreichend, dass sie das Aufgeben eines erheblichen Teils des westlichen Wohlstands verlangen. Entsprechend schwierig erweist es sich Singers Auffassung in Einklang mit dem moralischen „common sense“ zu bringen. Nach Erläuterung der normativen Prinzipien und des darunterliegenden ethischen Konzepts wird diskutiert, ob die daraus resultierenden Pflichten zu viel abverlangt um noch als plausible Handlungsanweisung gelten zu können. Es wird schließlich gezeigt, dass Singer diese Einwände erfolgreich abwenden kann.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1 Einführung
1.1 Armut und ethisches Handeln?
1.2 Armut und ethische Theorie?
2 Unsere Verpflichtung zu helfen
2.1 Die basalen Prinzipien
2.2 Der Fall des ertrinkenden Kindes
2.2.1 Intuitionen der Hilfe
2.2.2 Verteidigung der Analogie
3 Zu viel verlangt?
3.1 Ethik und Unparteilichkeit
3.2 Der Einwand der Überforderung
3.2.1 Psychologische und kognitive Unzumutbarkeit
3.2.2 Moralische Freiheit und Integrität
3.2.3 Persönlichen Belange und Beziehungen
3.2.4 Das „Principle of Sacrifice“ in einem Dilemma?
4 Verteidigung des Präferenzutilitarismus
4.1 Moralität auf zwei Ebenen
4.2 Die unparteiliche Rechtfertigung von Parteilichkeit
5 Konklusion - Singer als Strohmann?
6 Schlusswort
Literaturverzeichnis
Abstract
Die folgende Arbeit beschäftigt sich Peter Singers radikalem Verständnis von individuellen Hilfspflichten der westlichen Welt gegenüber global notleidenden Menschen. Diese sind so weitreichend, dass sie das Aufgeben eines erheblichen Teils des westlichen Wohlstands verlangen. Entsprechend schwierig erweist es sich Singers Auffassung in Einklang mit dem moralischen „common sense“ zu bringen. Nach Erläuterung der normativen Prinzipien und des darunterliegenden ethischen Konzepts wird diskutiert, ob die daraus resultierenden Pflichten zu viel abverlangt um noch als plausible Handlungsanweisung gelten zu können. Es wird schließlich gezeigt, dass Singer diese Einwände erfolgreich abwenden kann.
1 Einführung
1.1 Armut und ethisches Handeln?
Trotz aller historischen, kulturellen und politischen Vielfalt der Nationen unserer Erde gibt es ein Kriterium, nach dem man sie doch recht eindeutig aufteilen kann: arm und reich. Auf der einen Seite dieser Unterteilung, die Ausschlag gibt über die Erwartungen eines wohlentwickelten langen Lebens, steht die westliche Welt und das Leben im Überfluss. Auch hier bestehen zwar Probleme hinsichtlich der Verteilung des Reichtums und relativer Armut - aber im Großen und Ganzen genießen Europäer, Nordamerikaner und Australier ein Leben weit jenseits elementarer Bedürfnisbefriedigung mit unverdrossenem Konsum von Luxusgütern und einem ständigen Streben nach marginaler und relativer Verbesserung ihrer Verhältnisse.
Dem entgegen kann man ein Bild stellen, das der ehemalige Weltbankpräsident McNamara wie folgt widergegeben hat:
„Poverty at the absolute level [...] is life at the very margin of physical existence. The absolute poor are severely deprived human beings struggling to survive in a set of squalid and degraded circumstances almost beyond the power of our sophisticated imaginations and privileged circumstances to conceive..“ (McNamara 1976: 14)
Internationale Organisationen haben dem Leben in Hunger und elendigen Bedingungen auf der Erde den Kampf angesagt - und in der Tat hat sich etwa der Anteil der Weltbevölkerung, der von weniger als einem US$ pro Tag leben muss, von etwa 40% 1980 auf 20% in 2004 reduziert (Chen, Ravallion 2004). Trotzdem sterben jeden Tag 27.000 Kinder, denen Hilfsorganisationen aus finanziellen Engpässen nicht helfen können (Faigl 2008). Um auch nur annähernd die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu erreichen, werden nach aktuellen ökonomischen Schätzungen noch mindestens 10-15 Milliarden US$ benötigt (Sachs 2012). Dem Großteil der westlichen Bevölkerung fehlt allerdings die Bereitschaft zum ethischen Handeln, wenn es darum geht seine eigenen Ressourcen zu opfern. Und nicht nur das - es mangelt überhaupt an einer kohärenten ethischen Konzeption davon, wie viel wir eigentlich (ab)geben sollten.
1.2 Armut und ethische Theorie?
Zwar ist Ungleichheit per se typischerweise Gegenstand vieler philosophischer Untersuchungen der Verteilungsgerechtigkeit. Doch der offenbar viel dringendere Problemkomplex der globalen Armut hat lange keinen Weg in die akademische Gemeinschaft gefunden. So findet sich nicht einmal in dem Meilenstein der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, John Rawls über 500 Seiten langes „A Theory of Justice“, kein einziger Abschnitt über globale Gerechtigkeit. Erst der Artikel „Famine, Affluence & Morality“ des radikalen Denkers Peter Singer, der später noch für seine Tierbefreiungsethik und kontroverse bioethische Positionen bekannt werden sollte (Schuh 1996), hat eine Debatte um die moralischen Pflichten der Wohlhabenden gegenüber den Mittellosen angestoßen, die bis heute - aber das wiederum ist selbst in der praktischen Philosophie alles andere als atypisch - keinen Konsens gefunden hat.
Als Peter Singer 1972 seinen Essay „Famine, Affluence and Morality“ vor dem Hintergrund der humanitären Lage in Bangladesh nach einem Zyklonunglück und den Unabhängigkeitskämpfen schrieb, vereinfachte die Etablierung von Massen- und Transportmedien Hilfsmaßnahmen von westlicher Seite immer mehr. Ein beträchtlicher Teil der Empörung Singers war die Publizität solcher Katastrophen, aufgrund dessen niemand die Existenz des Kontrastes zwischen Reichtum im Überfluss und eklatanter Armut in unserer Welt mehr leugnen konnte (Singer 1972: 230). Diese Situation hat sich durch die technologische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, insbesondere durch die Entwicklung von Massenkommunikationsmedien, noch drastisch verschärft: Das Internet macht es jedem möglich sich ständig über die Notsituationen unserer Erde zu informieren und aktiv zu werden. Die Argumente Singers und die Frage nach der Pflicht zu helfen für die westliche Welt sind demzufolge aktueller als je zuvor.
Im folgenden Text werde ich ausführlich Peter Singers Auffassung über eine Verpflichtung gegenüber Individuen darstellen, deren essentielle Bedürfnisse grundsätzlich gefährdet sind. Dabei soll zunächst geschildert werden, auf Basis welcher ethischen Konzeption diese Aussagen getroffen werden. Ich werde dabei von jeglicher Bewertung empirischer Prämissen, etwa der Folgenabschätzung oder Effektivität von Spenden absehen und davon ausgehen, dass die Hilfeleistungen bei den Bedürftigen dieser Welt tatsächlich ankommt und das angesprochene Leid zu lindern vermag (siehe Singer 2010: 111 ff). Vielmehr möchte ich untersuchen, ob Singers Haltung den materiell Privilegierten nicht zu viel abverlangt oder sie zu sehr belastet, um eine plausible ethische Zielsetzung sein zu können. In dieser Hinsicht werde ich verschiedene Aspekte darstellen, und besonders auf Cullitys Vorwurf des argumentativen Dilemmas eingehen. Abschließend verteidige ich Singers Prinzipien und die Auffassung stark machen, dass sein anspruchsvoller Pflichtbegriff den Angriffen einer „demandingness objection“ standhalten kann.
2 Unsere Verpflichtung zu helfen
2.1 Die basalen Prinzipien
Das Hauptargument Singers lässt sich einfach zusammenfassen und findet sich konsequenterweise in abgewandelter Form so auch in seinen anderen Werken zur globalen Ethik.1 Die basalen normativen Prämissen lauten schlichtweg:
P1: Leiden und Tod aus dem Mangel an Nahrung, Obdach und medizinischer Versorgung sind (moralisch) schlecht.
P2: Wenn es in unserer Macht steht, etwas Schlechtes zu verhindern, ohne dabei etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung zu opfern, sollten wir das tun. (Singer 1972: 231)
Singer (1994: 292-293) argumentiert, dass beide Prämissen weit genug formuliert sind, um von Vertretern verschiedenster ethischer Auffassungen akzeptiert zu werden. Der Begriff des „moralisch Schlechten“ ist also bewusst so weit gehalten, dass man sein Argument unabhängig von der Akzeptanz seiner eigenen Version eines modernen Utilitarismus bewerten kann und muss. So wird auch der Begriff der „vergleichbaren moralischen Bedeutung“ nicht weiter spezifiziert und kann dadurch nicht- konsequentialistische Größen wie Rechte, diverse Gerechtigkeitsvorstellungen oder anderweitige Verpflichtungen umfassen. Allerdings wird sich dafür zeigen, dass bei der Frage nach dem, was konkret geopfert und gefordert werden kann und muss, erheblicher Diskussionsbedarf besteht.
Diese Prinzipien erscheinen von Grund auf intuitiv vertretbar. Gleichwohl ergibt sich laut Singers Interpretation hieraus das Paradox, dass trotz der scheinbaren Unumstrittenheit dieser Behauptungen sie eine radikale Veränderung der westlichen Lebensweisen mit sich brächten: „If it were acted upon […] our lives, our society, and our world would be fundamentally changed“ (Singer 1972: 231). Denn die maßgebende Unterstützung von Menschen in extremer Armut stellt sich nun als genuine moralische Pflicht dar und wird in seinem „Principle of Sacrifice“ (Arneson 2009: 267) artikuliert.
2.2 Der Fall des ertrinkenden Kindes
2.2.1 Intuitionen der Hilfe
Gegeben der geringen Anzahl von Menschen, die ihr Leben dem altruistischen Notlindern anderer widmen, scheinen wir naturgemäß nicht per se geneigt zu sein Fremden Hilfe anzubieten. Das allerdings muss nicht bedeuten, dass wir dazu nicht dennoch moralisch verpflichtet wären. Intuitionen spielen in Singers Konzeption von Ethik prinzipiell eine untergeordnete Rolle, da sie eher „ein Produkt von Erziehung und Ausbildung als eine Quelle genuiner moralischer Einsicht“ (Singer 1994: 373) sind und er eher die folgende Sicht vertritt2: „[O]ur moral intuitions about cases have no particular epistemic authority anyway“ (Arneson 2009: 286). Um die Inkonsistenz unserer Intuitionen hinsichtlich Hilfspflichten gegenüber Bedürftigen aufzudecken und sie daraufhin einer rationalen ethischen Konzeption zu unterwerfen, schildert er folgendes Gedankenexperiment:
„If I am walking past a shallow pond and see a child drowning in it, I ought to wade in and pull the child out. This will mean getting my clothes muddy, but this is insignificant, while the death of the child would presumably be a very bad thing.” (Singer 1972: 231)
Es entspricht also durchaus unserer intuitiven moralischen Überzeugung, dass wir jemandem in ärgster Not Hilfestellungen bieten müssen, wenn unser Opfer - also hier etwa das Ruinieren unserer Kleidung oder einen beachtlichen Zeitverlust im alltäglichen Leben - in keinem angemessenen Verhältnis zur Besserstellung des Bedürftigen steht. Und dabei handelt es sich weder um eine wohltätige noch eine sogenannte „supererogative“ Handlung (Singer 1972: 235). Das bedeutet, dass wir verpflichtet sind zu helfen und es moralisch falsch wäre es nicht zu tun; Der Fall des ertrinkenden Kindes stellt eine Veranschaulichung dieses normativen Hilfsprinzips dar (Singer 2010: 30).
2.2.2 Verteidigung der Analogie
2.2.2.1 Nähe
Um eine gültige Analogie zum Problemkomplex der globalen Armut herzustellen, verwirft Singer die äußerlichen Unterschiede und zeigt auf, dass diese moralisch irrelevant sind: Einerseits besteht bei konsequenter Anwendung eines unparteilichen Konsequentialismus (siehe 3.1) bei der Frage nach der Nähe zum Hilfsadressaten „no possible justification for discrimination on geographical grounds“ (Singer 1972: 232). Andererseits zeigt Kamm (1999: 178 ff) auf, dass auch andere Größen wie etwa die Nähe des Agenten zu wirksamen Mitteln, der Ursache der Gefahr oder auch Salienz jedenfalls bei der intuitiven Bewertung durchaus eine gewichtige Rolle spielen können. Der Beweis der Existenz gewisser Intuitionen und deren Erklärung begründen hingegen noch keine ethische Legitimation. Akzeptiert man Singers „Prinzip der gleichen Interessenabwägung“ (siehe 3.1), dann kann die zufällige Geburt eines Interessenträgers in ein abgelegenes Gebiet oder fremdes Land keine Rolle für die Behandlung nach ethischen Gesichtspunkten spielen3.
2.2.2.2 Hilfe relativ zu anderen
Der zweite offensichtliche Unterschied besteht darin, dass ich im Falle des Kindes die einzige Person bin, die im entscheidenden Moment effektive Hilfe leisten kann. Das Problem globaler Armut findet in einem größeren Rahmen statt, in dem ich einer von Millionen potenziellen Hilfeleistenden bin. Singer erkennt zwar an, dass dieser Umstand psychologisch, also in Bezug auf unsere Schuldgefühle, eine Rolle spielt. Dennoch fordert er entschieden: „[T]his can make no real difference to our moral obligation“ (Singer 1972: 233). In der Tat könnte ein Utilitarist sogar damit kontern, dass eine beliebige Geldeinheit als Spende einer Hilfsorganisation, unter einer angenommenen abfallenden Grenzproduktivität von Spenden, noch mehr Nutzen stiftet, wenn andere sich nicht an der Hilfsmaßnahme beteiligen.
Das Konzept des „fairen Anteils“ hingegen beantwortet die Frage nach individuellen und kollektiven Pflichten auf Basis der erforderlichen Hilfeleistung und aller möglichen Beitragenden. So vertritt etwa Liam Murphy (nach Arneson 2004: 35-36) die Ansicht, dass die Pflicht nicht mit der Nichterfüllung anderer zunehmen kann und dementsprechend jeder so viel geben sollte, dass ein optimales Ergebnis im Falle kollektiver Konformität erreicht würde - auch wenn das realistischerweise nicht der Fall ist. Letztendlich entscheidend ist allerdings, dass Hilfspflichten einen Grund haben müssen: Die Motivation die Bedürfnisse der Notleidenden zu befriedigen(Cullity 2007: 64 ff). Immerhin wären wir nicht zu einem geringeren Grad verpflichtet dem ertrinkenden Kind zu helfen, wenn sich zufällig noch ein weiterer Passant am Teich befindet (Singer 1972: 233).
[...]
1 In seinem Hauptwerk über die „Praktische Ethik“ benutzt er das Konzept eines „bestimmte[n] Grad[es] absoluter Armut“ (Singer 1993: 294) und in seinem Appell „Leben retten“ fügt er die empirische Prämisse hinzu, dass Leid durch Spenden an Hilfsorganisationen verhindert werden kann, ohne dass man sich selbst einem dementsprechenden Mangel aussetzt (Singer 2010: 30).
2 In manchen Stellen von Singers Ethik besitzen intuitive Urteile allerdings einen leicht argumentativen Charakter (Kamm 1999: 177). Singer (1999: 315) allerdings vertritt die Ansicht, dass jegliches Berufen auf Intuitionen eine ad hominem Argumentation darstellt.
3 Diese Forderung wird auch in anderen Themengebieten wie etwa Singers Diskussion der Asylproblematik (1994: 326 ff) oder seiner Tierethik (1994: 147 ff) ersichtlich.