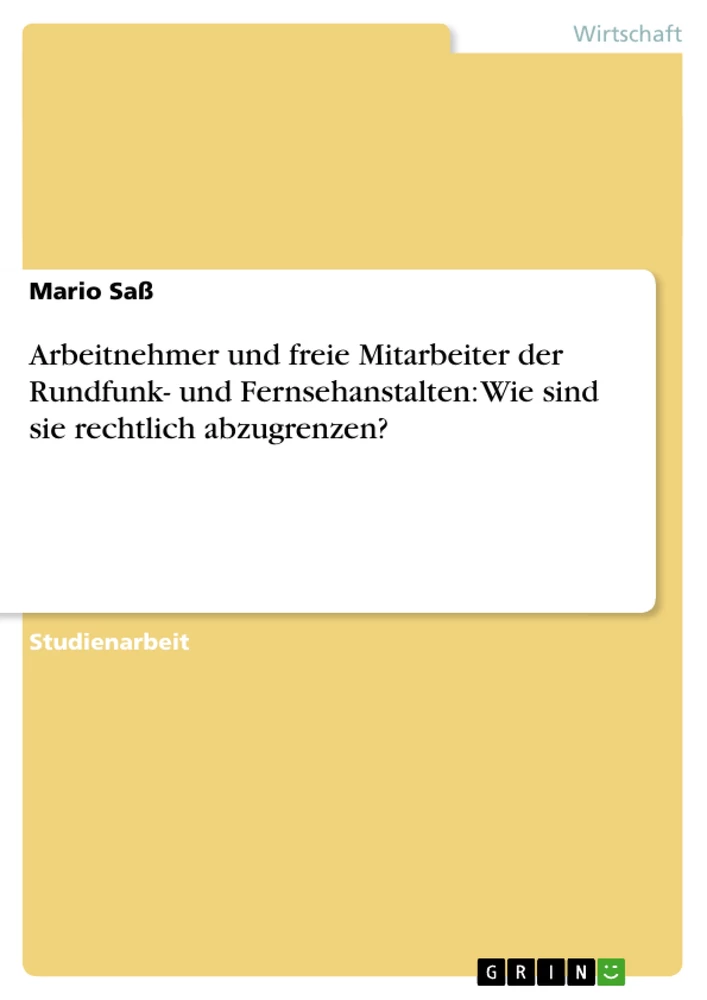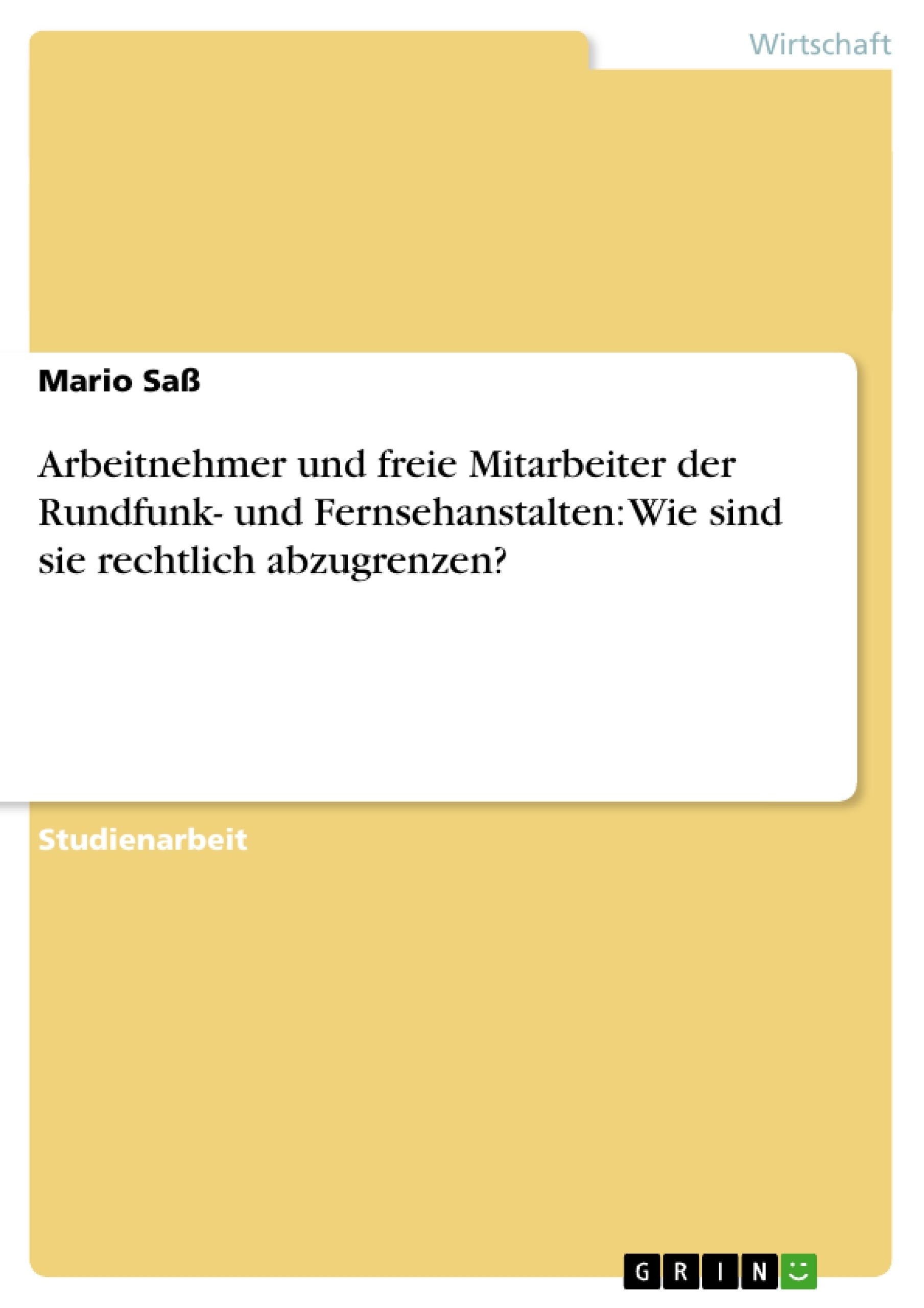[...] Weiterhin gab es bei den öffentlichen Anstalten ca. 13.000 und im Bereich
der privaten Veranstalter etwa 6.000 freie Mitarbeiter, welche sich noch nach festen freien, d.h.
solche, die regelmäßig für den gleichen Veranstalter tätig sind und den sonstigen freien
Mitarbeitern unterscheiden lassen.1 Nicht zuletzt aus diesen Zahlen wird deutlich, dass die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Informationswirtschaft sehr groß ist.
Allerdings unterscheiden sich Anstellungsverhältnisse bei Medienunternehmen von denen
anderer Unternehmen, welche nicht in dieser Branche tätig sind, da bei Arbeitsverträgen in
Rundfunk- und Fernsehanstalten der Kunst-, Presse- und Rundfunkfreiheit nach Art. 5 GG in
besonderer Weise Rechnung zu tragen ist.2
Weiterhin sind Medienunternehmen sehr daran interessiert, ihre Arbeitsverhältnisse flexibel zu
gestalten, da ein ständiger Wandel des Publikumsgeschmacks existiert, welchem mit starren und
unflexiblen Arbeitsverträgen kaum begegnet werden kann.3
Deshalb ist es Ziel dieser Arbeit, eine Abgrenzung der freien Mitarbeiter von den abhängig
beschäftigten Arbeitnehmern bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten herauszuarbeiten, um die
Wichtigkeit dieses Bereiches des Arbeitsrechtes für Medienunternehmen darzustellen.
Zunächst sollen grundlegende und allgemein gültige Begriffe wie der des Arbeitnehmers und der
des freien Mitarbeiters definiert und näher erläutert werden. Anschließend soll eine Abgrenzung
dieser beiden Personengruppen erfolgen und wesentliche Unterschiede herausgearbeitet werden.
Dabei wird hauptsächlich die Entwicklung nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 13. Januar 1982 zum Einfluss der Rundfunkfreiheit auf die Ausgestaltung von
Anstellungsverträgen mit Mitarbeitern in Medienunternehmen Beachtung finden. Diese
Rechtssprechung wurde durch das Bundesarbeitsgericht ständig fortentwickelt und soll in diesem
Zusammenhang ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt und erörtert werden.
Um ein Bild von den Möglichkeiten einer Anstellung bei einer Rundfunk- oder Fernsehanstalt zu
bekommen, werden Beispiele für Mitarbeiter in Medienunternehmen aufgezeigt und ausführlich
beschrieben. Den Abschluss der Arbeit bildet dann noch einmal eine Zusammenfassung der bis
dahin beschriebenen Punkte, die dann in einem Fazit enden.
1 Vgl. Ukena, Lockfeldt, S. 1
2 Vgl. Ukena, Lockfeldt, S. 1
3 Vgl. Bezani, Müller, S. 1
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen
2.1. Zum Begriff des Arbeitnehmers
2.2. Zum Begriff des freien Mitarbeiters
3. Abgrenzung von Arbeitnehmern und freien Mitarbeitern in Rundfunk- und Fernsehanstalten
3.1. Allgemeines
3.2. Der ursprüngliche Ansatz des Bundesarbeitsgerichts und dessen Folgen
3.3. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
3.4. Die Reaktionen des Bundesarbeitsgerichts
3.5. Aktuelle Urteile des Bundesarbeitsgerichts
3.6. Anwendung der Rechtsprechung auf Einzelfälle
3.6.1. Regisseur
3.6.2. Autor
3.6.3. Schauspieler
3.6.4. Redakteur
3.6.5. Sportreporter
3.6.6. Nachrichtensprecher und -übersetzer
3.6.7. Kameraassistent
4. Zusammenfassung und Schluss
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Medienunternehmen spielen in der heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle. Sie liefern Informationen, bieten aber auch ein breites Spektrum an Unterhaltung an. Da Vielfalt und Abwechslung vom Verbraucher gefordert werden, ist die Anzahl der Rundfunk- und Fernsehanstalten in den letzten Jahren rasant gestiegen, was auch den Wettbewerb untereinander stark beeinflusst hat. Weiterhin haben der technische Fortschritt und die zunehmende Bedeutung der Meinungsbeeinflussung durch Werbung ein Ansteigen der Medienunternehmen gefördert. Da hierdurch auch ein Wachstum der Mitarbeiter in dieser Branche zu verzeichnen ist, hat das Arbeitsrecht für diese eine wichtige Bedeutung.
Beispielsweise waren Ende 1998 ca. 40.000 feste Mitarbeiter bei den Rundfunkanstalten beschäftigt, wovon ca. 30.000 bei den öffentlich-rechtlichen und etwa 10.000 bei den privaten Sendern arbeiteten. Weiterhin gab es bei den öffentlichen Anstalten ca. 13.000 und im Bereich der privaten Veranstalter etwa 6.000 freie Mitarbeiter, welche sich noch nach festen freien, d.h. solche, die regelmäßig für den gleichen Veranstalter tätig sind und den sonstigen freien Mitarbeitern unterscheiden lassen.[1] Nicht zuletzt aus diesen Zahlen wird deutlich, dass die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Informationswirtschaft sehr groß ist.
Allerdings unterscheiden sich Anstellungsverhältnisse bei Medienunternehmen von denen anderer Unternehmen, welche nicht in dieser Branche tätig sind, da bei Arbeitsverträgen in Rundfunk- und Fernsehanstalten der Kunst-, Presse- und Rundfunkfreiheit nach Art. 5 GG in besonderer Weise Rechnung zu tragen ist.[2]
Weiterhin sind Medienunternehmen sehr daran interessiert, ihre Arbeitsverhältnisse flexibel zu gestalten, da ein ständiger Wandel des Publikumsgeschmacks existiert, welchem mit starren und unflexiblen Arbeitsverträgen kaum begegnet werden kann.[3]
Deshalb ist es Ziel dieser Arbeit, eine Abgrenzung der freien Mitarbeiter von den abhängig beschäftigten Arbeitnehmern bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten herauszuarbeiten, um die Wichtigkeit dieses Bereiches des Arbeitsrechtes für Medienunternehmen darzustellen.
Zunächst sollen grundlegende und allgemein gültige Begriffe wie der des Arbeitnehmers und der des freien Mitarbeiters definiert und näher erläutert werden. Anschließend soll eine Abgrenzung dieser beiden Personengruppen erfolgen und wesentliche Unterschiede herausgearbeitet werden.
Dabei wird hauptsächlich die Entwicklung nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-gerichts vom 13. Januar 1982 zum Einfluss der Rundfunkfreiheit auf die Ausgestaltung von Anstellungsverträgen mit Mitarbeitern in Medienunternehmen Beachtung finden. Diese Rechtssprechung wurde durch das Bundesarbeitsgericht ständig fortentwickelt und soll in diesem Zusammenhang ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt und erörtert werden.
Um ein Bild von den Möglichkeiten einer Anstellung bei einer Rundfunk- oder Fernsehanstalt zu bekommen, werden Beispiele für Mitarbeiter in Medienunternehmen aufgezeigt und ausführlich beschrieben. Den Abschluss der Arbeit bildet dann noch einmal eine Zusammenfassung der bis dahin beschriebenen Punkte, die dann in einem Fazit enden.
2. Grundlagen
2.1. Zum Begriff des Arbeitnehmers
Um im Folgenden den Begriff des Arbeitnehmers richtig gebrauchen zu können, soll in diesem Abschnitt eine Definition erfolgen. Eine gesetzliche Begriffsbestimmung des Arbeitnehmer-begriffs existiert nicht, jedoch ist sich die Rechtsprechung heute einig darüber, dass es sich bei einem Arbeitsvertrag um eine besondere Form des Dienstvertrages nach §§ 611 ff. BGB handelt.[4]
Doch nur allein durch die Art des Vertrages ist die Bestimmung eines Arbeitsverhältnisses nicht möglich. Vielmehr müssen, laut Bundesarbeitsgericht, weitere Kriterien erfüllt sein. Ein Hauptkriterium ist der Grad der persönlichen Abhängigkeit des Beschäftigten. Diese wird dadurch bestimmt, ob der Arbeitnehmer aufgrund des Dienstvertrages hinsichtlich der Zeit, des Ortes, der fachlichen Ausrichtung und der Art und Weise seiner geschuldeten Arbeit, den Weisungen seines Arbeitgebers oder dessen Bevollmächtigten unterliegt. Der Beschäftigte muss, um als Arbeitnehmer zu gelten, weisungsgebundene Tätigkeiten verrichten und sich in die ge-leitete Organisation des arbeitgebenden Unternehmens eingliedern.[5]
Die Ausprägung der persönlichen Abhängigkeit hängt, laut Bundesarbeitsgericht, von der Eigenart der zu leistenden Dienste ab. Hierbei gibt es allerdings keine allgemein geltenden Kriterien. Untergeordnete bzw. einfache Tätigkeiten weisen hiernach auf eine Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation, also auf ein Arbeitsverhältnis hin, wogegen dies bei höheren Diensten nicht immer der Fall ist. Natürlich kann bei höheren Tätigkeiten ebenfalls ein Arbeitsvertrag vorliegen, auch dann, wenn der Beschäftigte zum großen Teil selbständig arbeitet. Beispielsweise wird es einem Arbeitgeber kaum möglich sein, einem Chefarzt oder einem angestellten Rechtsanwalt Weisungen in dessen Fachgebieten erteilen zu können.
Andererseits ist nicht jede Weisungsgebundenheit ein Merkmal für einen Arbeitnehmer. Schließlich möchte ein Besteller beim Bestehen eines Werkvertrages Weisungen nach seinen Wünschen an den Werkunternehmer weitergeben können, ohne dass dieser Arbeitnehmer des Bestellers ist. Man kann also zusammenfassend sagen, dass das Ausführen von eher unter-geordneten, einfachen Tätigkeiten ein starkes Indiz für einen Arbeitsvertrag ist, aber dieses im Einzelfall immer geprüft werden muss.[6] Unwichtig für die rechtliche Bestimmung eines Arbeits-verhältnisses ist hingegen die wirtschaftliche Abhängigkeit, die nur bei der Unterscheidung zwischen arbeitnehmerähnlichen Personen und Selbständigen eine Rolle spielt.[7]
2.2. Zum Begriff des freien Mitarbeiters
Als Alternative zu einem Arbeitsverhältnis gibt es für ein Unternehmen auch die Möglichkeit, freie Mitarbeiter zu beschäftigen. Wie bereits beschrieben befindet sich ein Arbeitnehmer in einer persönlichen Abhängigkeit zu seinem Arbeitgeber. Im Gegensatz dazu ist das Verhältnis der freien Mitarbeit gerade nicht durch eine solche Abhängigkeit geprägt. Ein freier Mitarbeiter ist nicht in die Organisation des Arbeitgebers eingegliedert und ist somit eher ein außenstehender Dritter. Dies hat zur Folge, dass er keinem Weisungsrecht in Bezug auf Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort seiner geschuldeten Tätigkeit durch das arbeitgebende Unternehmen unter-liegt. Er leistet seine Arbeit vielmehr auf der Grundlage eines Dienst- oder Werkvertrags nach den §§ 611 ff. BGB und §§ 631 ff. BGB. Demnach führt er selbständig Aufträge durch, für die er vom Auftraggeber eine vorher vereinbarte Vergütung erhält. Natürlich hat der Besteller, wie der Auftraggeber auch genannt wird, das Recht das bestellte Werk während und nach der Erstellung auf dessen Qualität zu kontrollieren. Dabei kann er Änderungswünsche oder auch von Anfang an Kriterien festsetzen, nach denen das Werk entstehen soll, ohne dass dies als Weisungs-abhängigkeit für den Auftragnehmer, also den freien Mitarbeiter gilt.[8]
Die Unterscheidung zwischen einem Arbeitsverhältnis und dem einer freien Mitarbeit kann sehr schwierig sein, da der Grad der persönlichen Abhängigkeit in manchen Fällen nicht eindeutig bestimmt werden kann. Bei untergeordneten bzw. einfachen Tätigkeiten kann davon ausge-gangen werden, dass es sich um einen Arbeitnehmer handelt.[9] Allerdings gibt es viele Arbeiten, die sowohl in einem Arbeitsverhältnis als auch in einem freien Mitarbeiterverhältnis ausführbar sind. Im Bereich der Rundfunk- und Fernsehanstalten lassen sich die freien Mitarbeiter auch noch in feste freie und sonstige freie Mitarbeiter unterteilen.[10]
Weiterhin ist festzustellen, dass die Arbeitsgesetze bei einem freien Mitarbeiterstatus grund-sätzlich keine Anwendung finden, was dem Auftraggeber erhebliche Vorteile verschafft. Er braucht z.B. keine Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung zahlen, keinen Kündigungsschutz beachten, keine Fortzahlung im Krankheitsfall leisten, keinen Urlaub gewähren, keine Tarife beachten und keine Mitbestimmung gewähren. Der Arbeitgeber hat also durch die Beschäftigung eines freien Mitarbeiters enorme Kostenvorteile und die Attraktivität ein solches Verhältnis einzugehen ist demnach recht hoch. Aber auch der freie Mitarbeiter schätzt seine Vorteile, wie z.B. freie persönliche Entfaltungsmöglichkeiten, freie Einteilung der Arbeitszeit und des Arbeits-ortes und bessere Verdienstmöglichkeiten, da keine Lohnsteuerpflicht besteht.[11]
3. Abgrenzung von Arbeitnehmern und freien Mitarbeitern in Rundfunk- und Fernsehanstalten
3.1. Allgemeines
Im nachfolgenden Kapitel sollen die oben bereits definierten Begriffe des Arbeitnehmers und des freien Mitarbeiters in Rundfunk- und Fernsehanstalten genauer abgegrenzt werden. Dabei spielt die Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und auch des Bundes-verfassungsgerichts eine besondere Rolle, was in den weiteren Ausführungen Beachtung finden soll. Weiterhin wird im Folgenden gezielt auf Einzelfälle eingegangen, um an konkreten Beispielen deutlich zu machen, wie sich die Entscheidungen der Gerichte auf die Status-bestimmung von Mitarbeitern, speziell in Medienunternehmen, auswirken. Anschließend werden noch einige Beispiele für aktuelle gerichtliche Urteile zu diesem Thema gegeben.
Rundfunk- und Fernsehanstalten beschäftigen sowohl Arbeitnehmer als auch eine große Anzahl freier Mitarbeiter. Mit der Beschäftigung von freien Mitarbeitern werden Medienunternehmen ihrem Bedürfnis nach Flexibilität gerecht, da eine größere Bandbreite der Berichterstattung und eine schnelle Reaktion auf Programmentwicklungen gewährleistet werden kann. Ein weiterer Grund für das Nutzen der freien Mitarbeit liegt in den finanziellen, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorteilen für den Veranstalter.[12]
Rundfunk- und Fernsehanstalten bestehen meist auf den Einsatz freier Mitarbeiter, da sie hier-durch ein hohes Niveau und eine breite Informationsvielfalt erreichen, um somit ihrem ver-fassungsrechtlichen Auftrag gerecht werden zu können. Nicht zu vergessen ist hierbei, dass auch die freien Mitarbeiter selbst einen solchen Status wünschen, da ihnen hierdurch meist eine höhere finanzielle Entlohnung gegeben ist. Außerdem wird das außerordentlich hohe Maß an persönlicher Entfaltungs- und Gestaltungsfreiheit sehr geschätzt.[13]
Zu Beginn der 70er Jahre gab es kaum noch Wachstum bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten. Deshalb begannen viele freie Mitarbeiter der Veranstalter Statusklagen bei den zuständigen Arbeitsgerichten einzureichen, da sie um ihre Existenz fürchteten und als Arbeitnehmer an-erkannt werden wollten.[14] Zwischen 1974 und 1982 waren 450 von 550 Klagen erfolgreich.[15] Daraus ist ersichtlich, dass diese Erfolge eine Entwicklung des Arbeitnehmerbegriffs zu großen Teilen mitentwickelt haben. Schlagzeilen hat in dieser Hinsicht der Westdeutsche Rundfunk gemacht, welcher eine solche Einmischung in seine Personalangelegenheiten nicht akzeptieren wollte.
Deshalb erhob er 13 Verfassungsbeschwerden gegen Urteile des Bundesarbeitsgerichts und des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf. Daraufhin beschloss das Bundesverfassungsgericht am 13.01.1982, dass 12 der 13 Urteile die Pressefreiheit verletzen würden und übergab die Fälle zurück an die jeweiligen Gerichte.[16] Zu diesem Thema wird sich ein eigenes Unterkapitel dieser Arbeit noch näher beschäftigen.
Nach 1982 gab es weitere Statusklagen von Mitarbeitern diverser Rundfunk- und Fernseh-anstalten, zu denen sich das Bundesverfassungsgericht 1992 wiederum äußerte. Jedoch wurde auch in diesem Spruch keine eindeutige Klärung des Problems herbeigeführt.[17]
Selbst heute gibt es noch viele Klagen von Mitarbeitern in Medienunternehmen. Die meisten Verfahren, die im 5. Senat des Bundesarbeitsgericht verhandelt werden, beschäftigen sich mit genau diesen Fragen. Daran erkennt man, dass es noch viele Streitpunkte gibt, wenn es um die Bestimmung des Status eines Mitarbeiters geht.[18] Ziel der nun folgenden Unterkapitel ist es, Abgrenzungskriterien zu finden, die eine möglichst klare Einteilung in Arbeitnehmer oder freie Mitarbeiter zulassen sollen.
3.2. Der ursprüngliche Ansatz des Bundesarbeitsgerichts und dessen Folgen
Grundsätzlich gelten auch für Rundfunk- und Fernsehanstalten die vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Kriterien zur Unterscheidung von Arbeitnehmern und freien Mitarbeitern. Hierbei sei vor allem noch einmal das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit genannt, welches für ein Arbeitsverhältnis spricht. Dabei steht auch bei Medienunternehmen das Prüfen der Weisungs-abhängigkeit in Form von Inhalt, Zeit, Ort und Dauer der Tätigkeit im Vordergrund der Betrachtungen. Allgemein geltende Kriterien zur Abgrenzung von freier Mitarbeit und einem Arbeitsverhältnis lassen sich auch hier nicht finden. Vielmehr muss jeder Einzelfall betrachtet und alle Umstände berücksichtigt werden, um in diesem Punkt eine Aussage treffen zu können.[19] Am 15.03.1978 erlies das Bundesarbeitsgericht ein Grundsatzurteil, welches sich mit dem Status von Mitarbeitern in Rundfunk- und Fernsehanstalten befasste. Hierbei hatte das Gericht über eine Statusklage einer Filmautorin und Regisseurin zu entscheiden. Diese war bei der beklagten Rundfunkanstalt viele Jahre als freie Mitarbeiterin tätig und bekam für jedes Projekt, welches sie für die Sendanstalt bearbeiten sollte einen Vertrag.[20] Sie kreierte hauptsächlich kurze Filme zu unterschiedlichen Themen, welche ihr durch die Sendeanstalt jedoch vorgegeben wurden.
Die Klägerin schrieb das Drehbuch, dass durch die Redaktion des Senders abgenommen werden musste. Danach konnte die Produktion gestartet werden, in der die Mitarbeiterin dann als Regisseurin fungierte. Das technische Gerät sowie das Mitarbeiterteam wurden von der beklagten Sendeanstalt gestellt. Deshalb musste sich die Klägerin an die Arbeitszeiten dieses Teams halten. Hieraufhin entschied das Bundesarbeitsgericht, dass es sich bei der Mitarbeiterin um eine Arbeitnehmerin handelt, da es in den oben beschriebenen Umständen eine persönliche Abhängigkeit der Klägerin sehe. Der 5. Senat des Bundesarbeitsgerichts, welcher für derartige Statusklagen zuständig ist, begründete dieses Urteil wie folgt. Eine fachliche Weisungs-gebundenheit läge bei der Mitarbeiterin der Sendeanstalt nicht vor, da sie bei der Herstellung ihrer Filme überwiegend im geistigen und künstlerischen Bereich tätig war und die schöpferischen Arbeiten im Vorfeld der Produktion keine Festlegung nach Ort und Zeit erkennen ließen. Allerdings läge die persönliche Abhängigkeit, die ein Arbeitsverhältnis begründen würde, bei einem Personenkreis wie ihm die Klägerin angehört, vielmehr in einem anderen Punkt. Hiernach seien derartige Mitarbeiter der Rundfunk- und Fernsehanstalten auf deren technischen Apparat und die Arbeit in einem Team angewiesen, was eindeutig auf eine persönliche Abhängigkeit hinweise und somit als Arbeitsverhältnis zu werten sei.[21]
In den folgenden Jahren gab es viele weitere Urteile, bei denen das Bundesarbeitsgericht zur gleichen Entscheidung kam und mit den gleichen Argumenten, wie oben beschrieben, diese auch begründete. Durch diese Rechtsprechung wurden fast alle bis dahin freien Mitarbeiter der Rundfunk- und Fernsehanstalten zu Arbeitnehmern mit unbefristetem Arbeitsvertrag erklärt. Solche Mitarbeiter waren hauptsächlich Fernsehredakteure, Reporter, Regisseure, Drehbuch-autoren, Hörfunkkorrespondenten, Orchestermusiker und Komponisten.[22]
Das Bundesarbeitsgericht lies auch den Vorwurf nicht gelten, es würde durch seine Recht-sprechung die Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG verletzen. Vielmehr sei es doch not-wendig, den „arbeitsrechtlichen Bestandsschutz“ beizubehalten, da dieser ein wichtiger Teil des Sozialstaatsprinzips sei und somit beide, also sowohl Rundfunkfreiheit als auch Sozial-staatsprinzip, in ein richtiges Verhältnis und somit in Einklang zu bringen seien. Weiterhin sagte das Bundesarbeitsgericht, dass der „arbeitsrechtliche Bestandsschutz“ keineswegs unter die Rundfunkfreiheit zu ordnen sei. Man könne schließlich um diese ausreichend zu schützen einzelne programmgestaltende Mitarbeiter versetzen, da hierdurch die Freiheit gewahrt bleibe, ohne den Einfluss von Dritten über Programminhalte zu entscheiden. Es sei somit nicht nötig, einen besonderen Arbeitnehmerbegriff für Rundfunk- und Fernsehanstalten einzuführen.[23]
3.3. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 13.01.1982
Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sollte nicht lange ohne Folgen bleiben. Wie bereits erwähnt legte der Westdeutsche Rundfunk gegen zehn Urteile des Bundesarbeitsgerichts sowie weiteren drei des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf Verfassungsbeschwerde mit der Begründung ein, dass die Beschlüsse der Gerichte gegen das Grundrecht der Rundfunk- und Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG verstoßen würden. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass zwölf dieser Verfassungsbeschwerden berechtigt waren und verwies die entsprechenden Angelegenheiten zurück an das Bundesarbeitsgericht bzw. das Landesarbeits-gericht Düsseldorf. Dabei führte das Gericht aus, dass die Rundfunkfreiheit nicht nur vor dem Eingriff von außen in Bezug auf Inhalt und Ausgestaltung der Programme zu schützen sei, sondern sich dieser Schutz auch auf die Auswahl und Beschäftigung des Personals erstrecken müsse. Schließlich hänge ja die Gestaltung des Programms von diesen Menschen ab.[24]
[...]
[1] Vgl. Ukena, Lockfeldt, S. 1
[2] Vgl. Ukena, Lockfeldt, S. 1
[3] Vgl. Bezani, Müller, S. 1
[4] Vgl. Hohmeister, Goretzki, S. 27
[5] Vgl. Plander, S. 7
[6] Vgl. Bezani, Müller, S. 4
[7] Vgl. Plander, S. 7
[8] Vgl. Bezani, Müller, S. 3 ff.
[9] BAG in AP Nr. 4 zu § 611 BGB Zeitungsausträger
[10] Vgl. Ukena, Lockfeldt, S. 1
[11] Vgl. Hohmeister, Goretzki, S. 21 ff.
[12] Vgl. Ukena, Lockfeldt, S. 1
[13] Vgl. Bezani, Müller, S. 1
[14] Vgl. Dörr, S. 355 f.
[15] BVerfG in AP Nr. 1 zu Art. 5 Abs. 1 GG Rundfunkfreiheit
[16] BVerfG in AP Nr. 1 zu Art. 5 Abs. 1 GG Rundfunkfreiheit
[17] BVerfG in AP Nr. 5 zu Art. 5 Abs. 1 GG Rundfunkfreiheit
[18] Vgl. Bezani, Müller, S. 2
[19] Vgl. Ukena, Lockfeldt, S. 3
[20] BAG in AP Nr. 26 zu § 611 BGB Abhängigkeit
[21] BAG in AP Nr. 26 zu § 611 BGB Abhängigkeit
[22] Vgl. Bezani, Müller, S. 6f.
[23] BAG in AP Nr. 26 zu § 611 BGB Abhängigkeit
[24] BVerfG in AP Nr. 1 zu Art. 5 Abs. 1 GG Rundfunkfreiheit