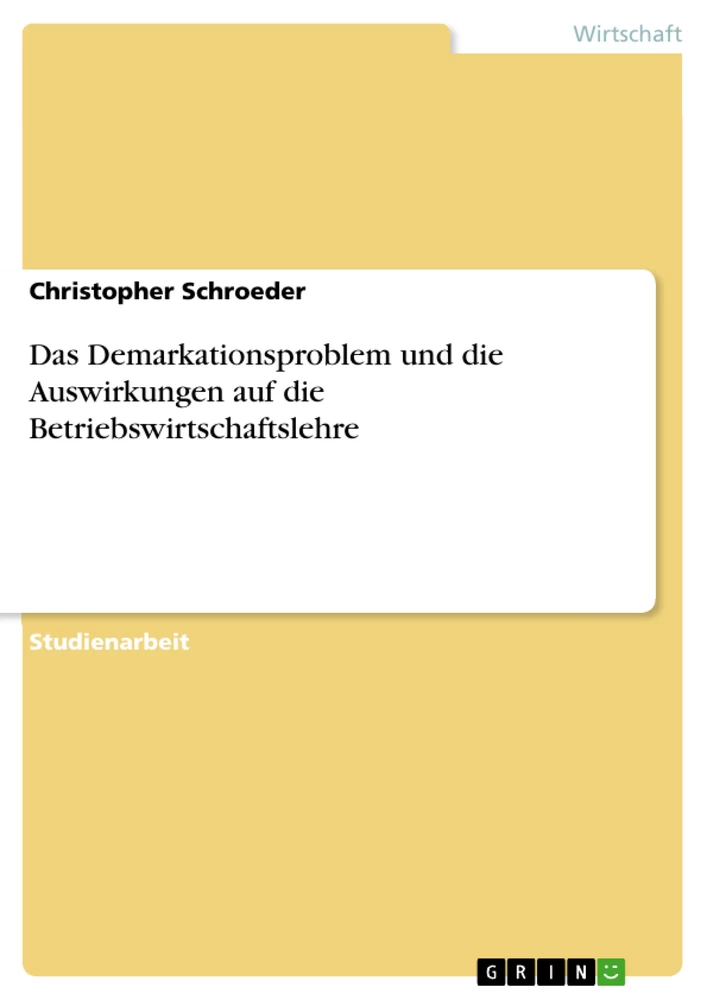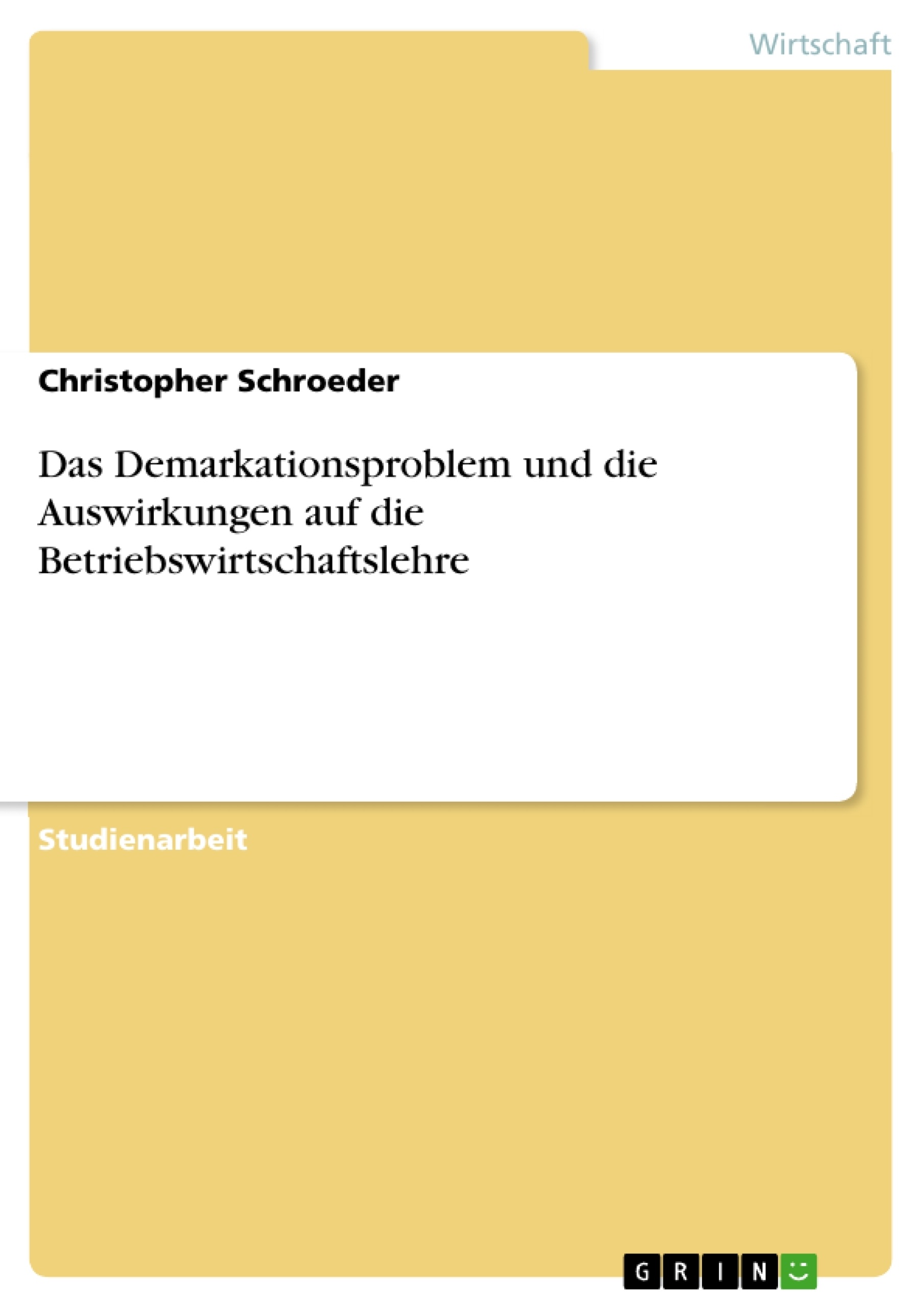Jeden Tag werden in Politik und Wirtschaft weitreichende Entscheidungen getroffen. Politische Gesetzte zur Ausgestaltung der Beziehungen von Unternehmen und ihren Aktionären oder die Frage der Ausgestaltung eines sind Beispiele für diese Art von Entscheidungen. Grundlage für diese Entscheidungen sind dabei häufig wissenschaftlichen Theorien. Hierbei gilt, dass die Qualität der Entscheidungen direkt mit der Qualität der Theorien zusammenhängt.
Es stellt sich damit die Frage, wann eine Theorie wissenschaftlich ist und wie man eine wissenschaftliche von einer unwissenschaftlichen Theorie unterscheiden kann. Dieses Problem wird in der Philosophie als Abgrenzungs- oder Demarkationsproblem behandelt. Dies ist auch für den Bereich der Betriebswirtschaftslehre (BWL) von Interesse, da hier eine Vielzahl von Theorien genutzt werden.
Diese Arbeit wird das Abgrenzungsproblem darstellen und verschiedene Lösungsansätze der letzten Jahre skizzieren. Die Lösungsansätze werden den jeweiligen Haupt-vertretern zugeordnet. Es wird im Weiteren untersucht, in wie fern das Abgrenzungsproblem Auswirkungen auf die BWL hat. Dazu wird die Betriebswirtschaftslehre im System der Wissenschaften verortet und das Abgrenzungsproblem auf die Betriebswirtschaftslehre angewandt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Demarkationsproblem
2.1. Definition
2.2. Wissenschaftlicher Forschungsprozess
3. Lösungsansätze
3.1. Karl R. Popper
3.2. Thomas S. Kuhn
3.3. Martin Gardner
3.4. Paul R. Thagard
3.5. Larry Laudan
3.6. Gerhard Schurz
4. Das Demarkationsproblem in der Betriebswirtschaftslehre
4.1. Die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft
4.2. Anwendung der Abgrenzungskriterien
4.3. Auswirkung des Abgrenzungsproblems
5. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis