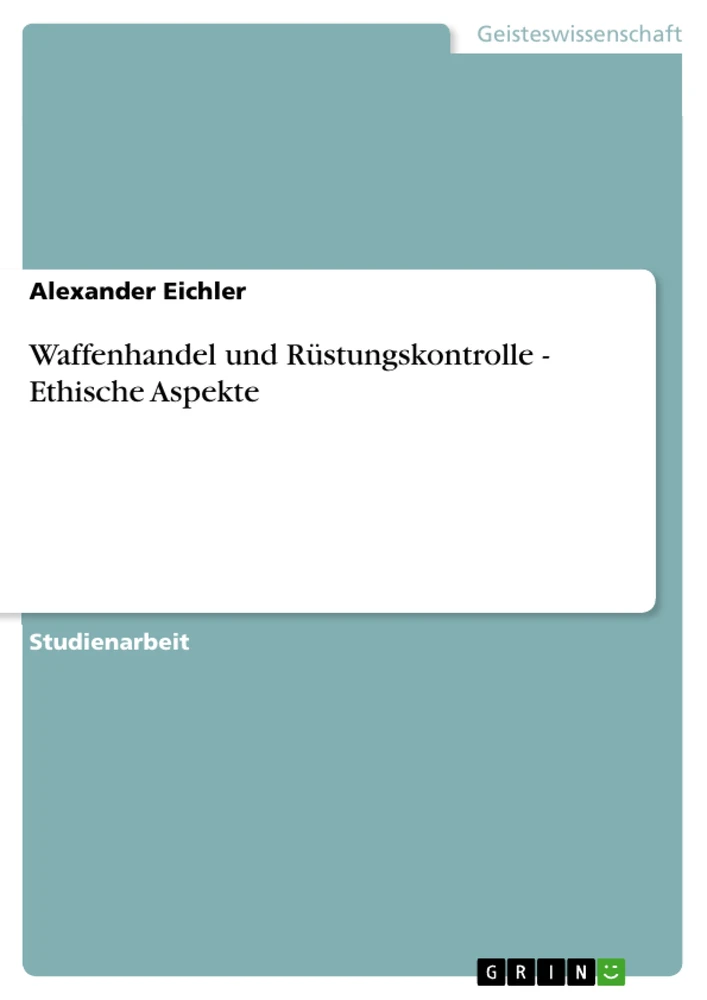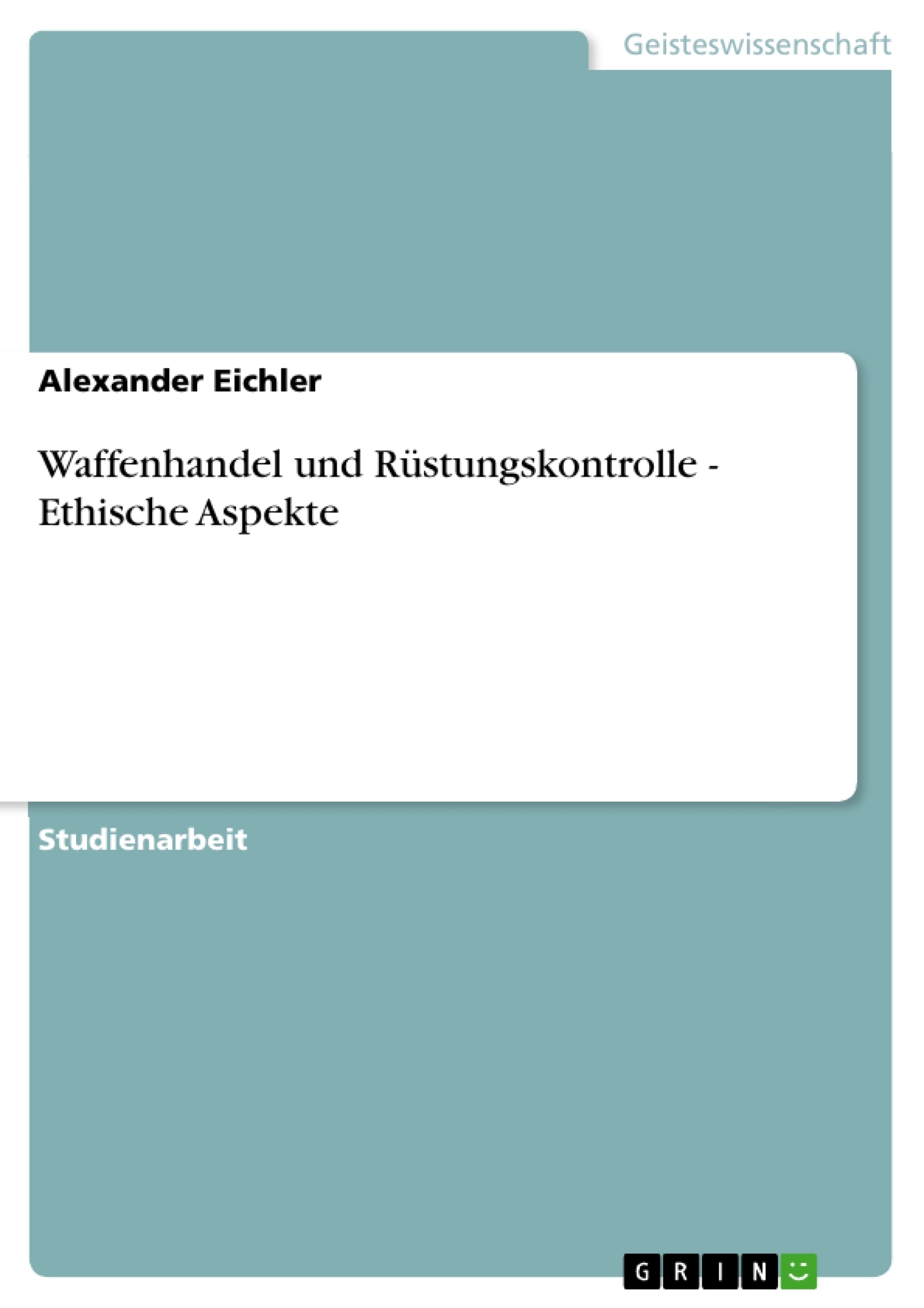Waffenhandel, Rüstungskontrolle und Abrüstung sind entscheidende Gebiete der diplomatischen und zivilen Krisenbewältigung unserer Zeit. Allgemein wird die Ansicht vertreten, dass Rüstungen als Vorbereitungen kriegerischer Handlungen bzw. konfliktfördernd wirken. Aus diesem Grund formulierte man in der UN-Charta die Verhinderung künftiger Kriege als das wichtigste Ziel der internationalen Gemeinschaft, wobei Waffengewalt nur noch als Ultima Ratio dienen sollte. Trotzdem wurde die internationale Politik jahrzehntelang vom gegenseitigen Wettrüsten und der Drohung mit Gewalt zwischen den USA und der Sowjetunion bestimmt. Erst durch die Auflösung des Systems der Blöcke und durch den Dreistufenplan von Mickail Gorbatschow aus dem Jahr 1986 wurde der Weg für eine Zeit der Abrüstung freigemacht. Zwar wurden eine Fülle von Abrüstungsverträgen, die bei der Überwindung der Blockkonfrontation des Kalten Krieges helfen sollten, unterzeichnet, doch letztendlich vergrößerte sich durch den Zerfall der Sowjetunion die Menge der potenziell verfügbaren Waffen. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzte ein Wandel im weltweiten Waffenhandel ein, denn war es Mitte des letzten Jahrhunderts noch so, dass sich nur reiche Industrienationen teures Kriegsgerät leisten konnten, so findet seit den 1980er Jahren eine gegenteilige Entwicklung statt. Der Anteil der Entwicklungsländer als Kunden am weltweiten Waffenhandel steigt kontinuierlich an, da der ehemalige Bündniszuliefermarkt zu einem weltweiten Exportmarkt wurde.
Heute, im 21. Jahrhundert, ist die Ära der klassischen zwischenstaatlichen Kriege längst zu Ende und auch die „Spielregeln“ der nuklearen Abschreckung, wie sie noch vor 40 Jahren galten, sind überholt. Durch die technologische Entwicklung wurden Staatenkriege zunehmend unführbar, denn die Vernichtungskraft von Nuklearwaffen und die Verletzlichkeit der modernen vernetzten Gesellschaften würden bei einem erneuten Weltkrieg eine globale Katastrophe auslösen. Dadurch, dass die USA ohne gleichartigen Kontrahenten als Führungsmacht der westlichen Welt fungieren, hat es den Anschein, dass die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges reduziert ist und der lang ersehnte Frieden auf der Welt einkehren kann. Jedoch trügt dieser Eindruck, denn seit den letzten Jahren lassen sich folgende Entwicklungstendenzen erkennen:
Gliederung
1. Einleitung
2. Rüstungspolitik: Zahlen, Daten und Fakten
3. Waffenhandel und Rüstungskontrolle
3.1. Warum rüsten Staaten auf?
3.2. Welche Konsequenzen resultieren aus dem globalen Waffenhandel?
3.3. Ethische Aspekte als Grundlage für Frieden in der Welt
4. Perspektivenwechsel in der Friedensethik: Auch in der Rüstungspolitik?
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Waffenhandel, Rüstungskontrolle und Abrüstung sind entscheidende Gebiete der diplomatischen und zivilen Krisenbewältigung unserer Zeit. Allgemein wird die Ansicht vertreten, dass Rüstungen als Vorbereitungen kriegerischer Handlungen bzw. konfliktfördernd wirken. Aus diesem Grund formulierte man in der UN-Charta die Verhinderung künftiger Kriege als das wichtigste Ziel der internationalen Gemeinschaft, wobei Waffengewalt nur noch als Ultima Ratio dienen sollte.1 Trotzdem wurde die internationale Politik jahrzehntelang vom gegenseitigen Wettrüsten und der Drohung mit Gewalt zwischen den USA und der Sowjetunion bestimmt. Erst durch die Auflösung des Systems der Blöcke und durch den Dreistufenplan von Mickail Gorbatschow aus dem Jahr 1986 wurde der Weg für eine Zeit der Abrüstung freigemacht.2 Zwar wurden eine Fülle von Abrüstungsverträgen, die bei der Überwindung der Blockkonfrontation des Kalten Krieges helfen sollten, unterzeichnet, doch letztendlich vergrößerte sich durch den Zerfall der Sowjetunion die Menge der potenziell verfügbaren Waffen. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzte ein Wandel im weltweiten Waffenhandel ein, denn war es Mitte des letzten Jahrhunderts noch so, dass sich nur reiche Industrienationen teures Kriegsgerät leisten konnten, so findet seit den 1980er Jahren eine gegenteilige Entwicklung statt.3 Der Anteil der Entwicklungsländer als Kunden am weltweiten Waffenhandel steigt kontinuierlich an, da der ehemalige Bündniszuliefermarkt zu einem weltweiten Exportmarkt wurde.4
Heute, im 21. Jahrhundert, ist die Ära der klassischen zwischenstaatlichen Kriege längst zu Ende und auch die „Spielregeln“ der nuklearen Abschreckung, wie sie noch vor 40 Jahren galten, sind überholt. Durch die technologische Entwicklung wurden Staatenkriege zunehmend unführbar, denn die Vernichtungskraft von Nuklearwaffen und die Verletzlichkeit der modernen vernetzten Gesellschaften würden bei einem erneuten Weltkrieg eine globale Katastrophe auslösen. Dadurch, dass die USA ohne gleichartigen Kontrahenten als Führungsmacht der westlichen Welt fungieren, hat es den Anschein, dass die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges reduziert ist und der lang ersehnte Frieden auf der Welt einkehren kann. Jedoch trügt dieser Eindruck, denn seit den letzten Jahren lassen sich folgende Entwicklungstendenzen erkennen:
Wie bereits beschrieben, kommt es zwar zu einer Entmilitarisierung der Sicherheitspolitik zwischen Ost und West, aber parallel auf der anderen Seite zu einer Militarisierung neuer Politikbereiche zwischen Nord und Süd. Hier ist der Prozess der Globalisierung und die zunehmende ökonomische und ökologische Verwundbarkeit ein entscheidendes Kriterium für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Staaten. Außerdem führt die Suche nach neuen Absatzmärkten speziell in der Dritten Welt zu einer Autonomisierung und zu ethnonationalistischen Souveränitätsbestrebungen, die häufig Menschenrechtsverletzungen zur Folge haben.5
Aktuell ist das Thema Rüstungsexport wieder schlagzeilenträchtig und wird tief mit wirtschaftlichen, sozialen, politischen, ethischen, religiösen und kulturellen Fragen verbunden. Täglich erfährt man in den verschiedenen Medien von billigen Kriegen mit einfach zu beschaffenen Waffen und unprofessionellen Soldaten. Während beispielsweise in Deutschland der Militärhaushalt jährlich verringert wird und eine selbstständige Landesverteidigung für die Bundeswehr nahezu unmöglich erscheint, vergrößert sich der Kreis der kriegsführungsfähigen Parteien auf der Welt beständig. Diese „neuen Kriege“ lassen sich von traditionellen Kriegen deutlich unterscheiden. Sie dauern nicht Monate oder Jahre, sondern Jahrzehnte, kennen keine Kriegserklärung oder reguläre Armeen, die sich bekämpfen, und haben eine ganz neue Form der Gewalt hervorgebracht - den internationalen Terrorismus. Solche gewalttätigen Konflikte, die auch als „Ressourcenkriege“ bezeichnet werden, finden häufig an der Peripherie der Wohlstandszonen statt und nutzen ethnische Unterschiede gnadenlos aus. Gerade anhand der Zunahme autoritärer politischer Regime in der Dritten Welt, die als Ursache und Wirkung der neuen low intensity wars anzusehen sind, kann man die Verbindung zur Weltwirtschaft erkennen, da die „neuen Kriege“ ihre Energie aus dem Waffenhandel beziehen. Unglücklicherweise ist es bis jetzt noch nicht gelungen funktionierende Sanktionen zu etablieren, denn weiterhin treffen politische Embargos zumeist nur die Zivilbevölkerung.6
Diese Spannungsfelder prägen die Diskussion über Abrüstung und Rüstungskontrollpolitik und werden in der vorliegenden Arbeit besonders unter ethischen Aspekten beleuchtet.
Hierbei sollen zunächst Gründe für das Aufrüsten eines Staates und deren Konsequenzen erläutert werden, um am Ende mit Hilfe des Perspektivenwechsels in der Friedensethik, für die Problematik des Waffenhandels mögliche Auswege aufzuzeigen.
2. Rüstungspolitik: Zahlen, Daten und Fakten
Deutschland ist aktuell nach den USA und Russland der drittgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Vor allem durch U-Boote und Panzerfahrzeuge konnte die Bundesrepublik ihre Exportmenge in den letzten Jahren mehr als verdoppeln. Laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI7 stieg der Weltmarktanteil Deutschlands auf etwa 11%8 an. Von 2000 bis 2004 betrug der Anteil am weltweiten Rüstungsexport noch 6%, wobei man konsequenterweise sagen muss, dass 1991 eine ähnlich hohe Konstellation aufgrund des Verkaufs und der Weitergabe von ehemaligem Rüstungsgerät der NVA vorgelegen hat. Zu den wichtigsten Abnehmerländern deutscher Rüstungsgüter gehören die Türkei, Griechenland und Südafrika. Kurioserweise zählte das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland in den vergangenen Jahren zu den fünf größten Rüstungskäufern der Welt, was nebenbei bemerkt angesichts der zurzeit geführten politischen Debatten innerhalb der Europäischen Union mehr als grotesk erscheint. Aus gutem Grund fordert der Bundestag deshalb seit Langem ein Vetorecht bei Waffengeschäften, damit er das Recht hat, die Bundesregierung bei ihrem Rüstungsexport stärker zu kontrollieren.9
Doch keinesfalls ist die Tendenz steigender Rüstungsexporte ein rein deutsches Phänomen. Weltweit registrierte man in den letzten fünf Jahren einen Anstieg des Waffenhandels um 22%. Ein besonderes Wettrüsten findet aktuell im Bereich der Kampfflugzeuge statt, wobei speziell die USA darauf bedacht sind, ihre führende Rolle auf diesem Gebiet zu manifestieren. Aber auch in Spannungsgebieten wie dem Nahen Osten, Nordafrika, Südamerika sowie in Süd- und Ostasien ist der Rüstungswettlauf deutlich erkennbar. Die als sehr innovativ geltende deutsche Rüstungsindustrie ist deshalb darauf bedacht, die hohen deutschen Exportbarrieren zu umgehen, da das starre Festhalten an bisherigen Kontrollmechanismen die einheimische Rüstungswirtschaft und deren Überlebenschancen gefährde. Deshalb warnen deutsche Rüstungsvertreter vor Wettbewerbsverzerrungen und Beschränkungen der leistungsfähigen Unternehmen, die zunehmend zu einer Isolation der deutschen Rüstungsindustrie führe. Besonders der Rückgang der Beschäftigtenanzahl im Bereich Wehrtechnik seit 1990 von ca. 280.000 auf ca. 180.000 Ende 1993 wird gern als Argument vorgebracht, um die politische Führung unter Druck zu setzen, die Exportbestimmungen zu lockern.10
Sicherlich ist eine eigene autonome Rüstungsindustrie mitentscheidend für den außen- und sicherheitspolitischen Einfluss eines Staates und seine politischen Gestaltungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene. Aber auf der anderen Seite ist für die am Export orientierte deutsche Wirtschaft die Rüstungsindustrie längst kein Fortschrittsmotor mehr. Auch die politische Bedeutung der BRD steht und fällt nicht durch den Erhalt oder Verlust der nationalen rüstungsindustriellen Basis. Daher stellt man Überlegungen an, ob es nicht effektiver sei, eine arbeitsteilig organisierte Rüstungsindustrie der Europäischen Union zu etablieren, die zusätzlich ein Signal gemeinsamer Zusammenarbeit aussenden würde. Die BRD, die besonders im Bereich Werkzeugmaschinen- und Anlagenbau äußerst fortschrittlich ist, könnte so weiterhin als Zulieferer fungieren und trotzdem wären Einsparungsmaßnahmen, die ein beschränktes Budget und einen verkleinerten Militärhaushalt bedingen, weiterhin im Bereich des Möglichen.11 Auch wenn die Forderungen der Rüstungsindustrie damit nicht erhört werden würden und der Hinweis auf negative Beschäftigungseffekte kaum Beachtung erhalten würde, so muss man letztendlich sagen, dass das bereits angesprochene Arbeitsplatzargument für eine Lockerung der Rüstungsexportkontrollen instrumentalisiert wird und ethisch nicht ausreicht, um die Rüstungsexportindustrie zu legitimieren.
3. Waffenhandel und Rüstungskontrolle
In diesem Kapitel wird nun explizit auf die Themen Waffenhandel und Rüstungskontrolle eingegangen. Dafür werden die Begriffe zunächst definiert, um sie anschließend im aktuellen Kontext zu beleuchten.
Durch das notorische Scheitern der Abrüstungspolitik Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde das Alternativkonzept Rüstungskontrolle aufgegriffen, um das schier unbegrenzte Wettrüsten einzelner Staaten zu begrenzen. Grundsätzlich orientieren sich beide Konzepte am Ziel der Friedenssicherung und Konfliktvermeidung, wobei die Möglichkeit besteht, dass Rüstungskontrolle zu Abrüstungstätigkeiten führen kann. Betrachtet man den Begriff Rüstung, so sind damit Waffen und sonstige Güter, die typischerweise von Streitkräften verwendet werden, gemeint. Es gehören aber auch Güter und Dienstleistungen die militärische Zwecke erfüllen dazu. Rüstung ist nach verbreiteter Ansicht ein ethisch ambivalenter Begriff, der oftmals weniger zur Konflikteindämmung, als zur Intensivierung vorhandener Spannungen führt.12
Unter Waffenhandel versteht man ein Synonym für den Modus der Weitergabe von Waffen und sonstigen rüstungsrelevanten Gütern und Dienstleistungen. Wichtig ist hier die genaue Abgrenzung zur Proliferation von ABC-Waffen, ballistischen Trägersystemen und anderen Technologien, da das Problem des Rüstungstransfers in verschiedene Kategorien eingeteilt wird. Hauptsächlich differenziert man den Transfer von klassischen oder konventionellen kriegstauglichen Waffen, rüstungsrelevanter Technologie und die Weiterverbreitung von ABC-Waffen. Hierbei fungiert in Deutschland das Kriegswaffenkontrollgesetz als Ausführungsgesetz zu Art. 26 Abs. 2 GG, denn beispielsweise besagt es, dass die Herstellung von Kernwaffen einer Genehmigung bedarf und dass der Handel mit solchen Waffen verboten ist. Außerdem gehören Antipersonenminen sowie Sprengmunition zu den Waffensystemen, die laut Kriegswaffenkontrollgesetz nicht verwendet werden dürfen.13
Beim Transfer von Waffen sind die Kontrollpraxis und die restriktive Genehmigungspraxis der Staaten von entscheidender Bedeutung. Besonders der Handel mit sensibler Technologie, der Wissenstransfer, der Kauf von Know-how, Dienstleistungen und Industrieanlagen muss streng überwacht werden, um weitere Konflikte zu vermeiden. Des Weiteren sollten sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl militärisch als auch zivil nutzbar sind, zum Kriegsmittelbegriff hinzugefügt werden, da sie nicht weniger friedensbedrohend sind, als der Export von Waffen und eigens für militärische Zwecke konstruierte Güter. Durch eine Neukonzeption des Kampfmittelbegriffs würden nicht nur Waffen, die eine direkte zerstörerische Wirkung entfalten können, sondern auch alle Materialien, die für militärische Zwecke konzipiert oder zur militärischen Verwendung abgeändert werden können umfasst und unter neuen internationalen Standards geregelt werden.14
[...]
1 Vgl. FASSBENDER, Bardo, in: zur sache.bw, Kein Krieg, nirgends, Nummer 17. 2010, S. 4-7.
2 Vgl. HUBER, Wolfgang/ REUTER, Hans-Richard, Friedensethik, Stuttgart/Berlin/Köln 1990, S. 141.
3 Vgl. SCHUBERT, Hartwig von, Friedensethik im Einsatz. Ein Handbuch der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr, Gütersloh 2009, S. 149.
4 Vgl. MÜNKLER, Herfried, in: zur sache.bw, Zum ewigen Frieden?, Nummer 17. 2010, S. 8-15. Siehe auch: MIERZWA, Roland, Katholische Kirche und Rüstungshandel. Analyse und Dokumentation, Bad Vilbel 1994, S 22.
5 Vgl. EBELING, Klaus, Der Handel mit Rüstungsgütern als Anfrage an eine Ethik der Politik. Eine Problemskizze, in: Deutsche Kommission Justitia et Pax (Hrsg.), Der Handel mit Rüstungsgütern als Anfrage an eine Ethik der Politik, Stuttgart 1992, S. 3-6.
6 Vgl. MIERZWA, Roland, Katholische Kirche und Rüstungshandel, S. 23.
7 Stockholm International Peace Research Institute stellt Untersuchungen zur Rüstungsstärke von Staaten an.
8 Zum Vergleich machen die USA ca. 30% und Russland ca. 23% am Weltmarktanteil aus.
9 Vgl. ZEITONLINE, Deutschland verdoppelt Rüstungsexporte.
10 Vgl. EBELING, Klaus, Rückwärts nach Europa? Die aktuelle Kontroverse um die deutsche Rüstungspolitik, in: Herder Korrespondenz 48 (1994), S. 186-187.
11 Vgl. EBELING, Klaus, Rückwärts nach Europa?, S. 188-189.
12 Vgl. HOPPE, Thomas, Rüstung, in: Hunold, Gerfried W. (Hrsg.), Lexikon der christlichen Ethik, Bd. 2, Freiburg/Basel/Wien 2003, 2006/2007.
13 Vgl. EBELING, Klaus, Waffenhandel, in: Hunold, Gerfried W. (Hrsg.), Lexikon der christlichen Ethik, Bd. 2, Freiburg/Basel/Wien 2003, 2006/2007.
14 JUSTITIA ET PAX (Schweizerische Nationalkommission) / Institut für Sozialethik des S.E.K., Waffenexporte aus christlicher Sicht. Überlegungen zur Revision des Kriegsmaterialgesetzes, Bern 1994, S. 1-4.