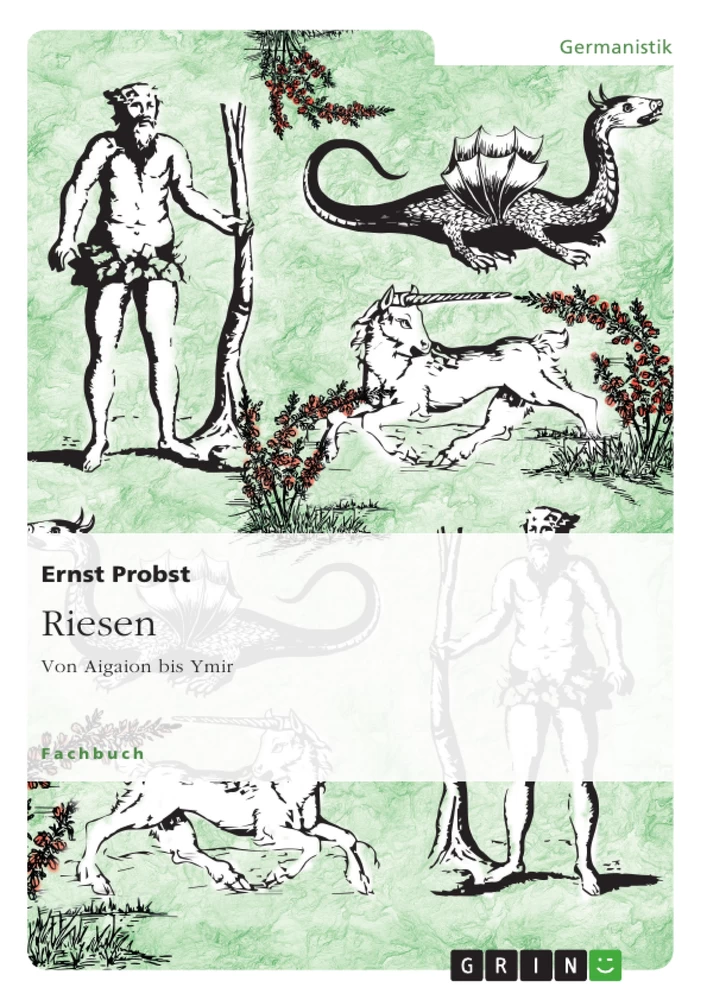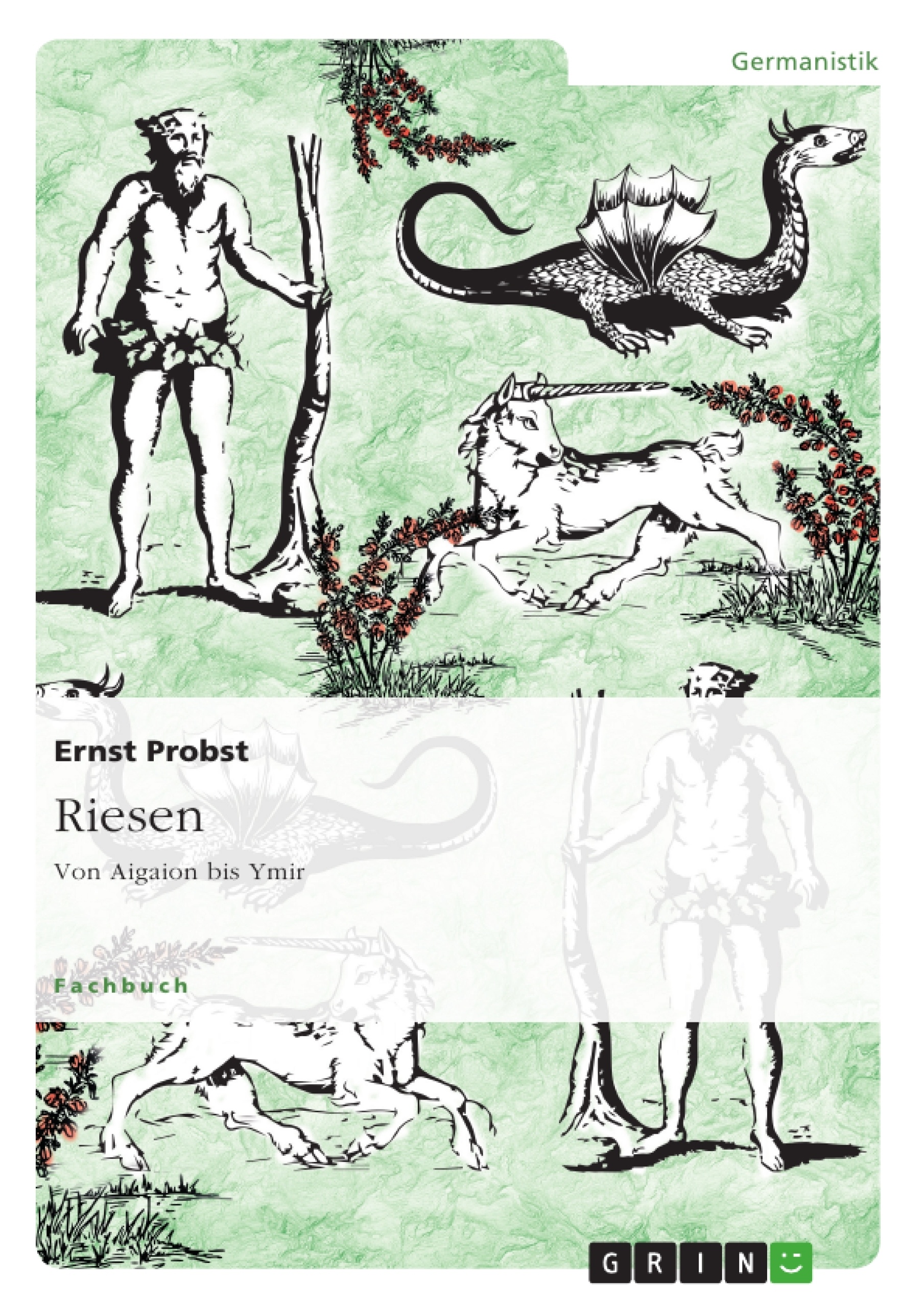Goliath, Polyphem, Ymir, Rübezahl und andere Riesengestalten geistern durch die Sagenwelt. Alle Völker dieser Erde kennen solche Wesen von unglaublicher Größe mit übermenschlichen Kräften. Einmal gelten sie als wahre Tölpel, die nur rohe Kraft walten lassen, dann wieder sind sie Helden oder sogar Schöpfer der Welt. In Wirklichkeit haben Riesen zu keiner Zeit unseren Planeten bevölkert. Sie sind nur Ausgeburten menschlicher Phantasie. Zur Entstehung der Sagen über Riesen trugen in früheren Jahrhunderten vor allem Funde prähistorischer Tiere – wie Mammute oder Zwergelefanten –, deren wahre Natur man ehedem nicht erkannte, bei. Der Wiesbadener Autor Ernst Probst hat sich im Reich der zweibeinigen Giganten umgesehen. Hierüber schrieb er das reich bebilderte kleine Taschenbuch „Riesen. Von Aigaion bis Ymir“. Dieses ist seinem Enkel Max Werner und seiner Enkelin Paula Werner gewidmet, die sich beide für Monster besonders interessieren.
VORWORT
Von Aigaion bis zu Ymir
Goliath, Polyphem, Ymir, Rübezahl und andere Riesengestalten geistern durch die Sagenwelt. Alle Völker die- ser Erde kennen solche Wesen von unglaublicher Größe mit übermenschlichen Kräften. Einmal gelten sie als wahre Tölpel, die nur rohe Kraft walten lassen, dann wieder sind sie Helden oder sogar Schöpfer der Welt.
In Wirklichkeit haben Riesen zu keiner Zeit unseren Planeten bevölkert. Sie sind nur Ausgeburten menschlicher Phantasie. Zur Entstehung der Sagen über Riesen trugen in früheren Jahrhunderten vor allem Funde prähistorischer Tiere - wie Mammute oder Zwergelefanten -, deren wahre Natur man ehedem nicht erkannte, bei.
Der Wiesbadener Autor Ernst Probst hat sich im Reich der zweibeinigen Giganten umgesehen. Hierüber schrieb er das reich bebilderte kleine Taschenbuch „Riesen. Von Aigaion bis zu Ymir“. Dieses ist seinem Enkel Max Werner und seiner Enkelin Paula Werner gewidmet, die sich beide für Monster besonders interessieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grab von Karl Georg von Raumer (1783-1865)
auf dem Neustädter Friedhof in Erlangen. Raumer hielt Fossilien
für verunglückte Probeschöpfungen der Natur.
Es war nicht die Spur von Noahs Raben
Es war nicht die Spur von Noahs Raben
Kuriose Irrtümer in der Geschichte der Paläontologie
Die Geschichte der Paläontologie, der Lehre vom Leben in der Urzeit, ist voller skurriler Irrtümer. Lange wollte niemand glauben, dass die Reste von prähistorischen Pflanzen und Tieren viele Millionen Jahre alt sind. Es vergingen etliche Jahrhunderte, bevor allerlei merkwürdige Erklärungen über die Entstehung von Fossilien als Unsinn erkannt wurden.
Eine der frühesten Fehldeutungen von Fossilien unterlief dem griechischen Philosophen Aristoteles im 4. Jahrhundert v. Chr. Er verkannte solche Urzeitfunde als „Figurensteine“, die durch schöpferische Kräfte im „Urschlamm“ entstanden seien.
Anhänger der Sintfluttheorie betrachteten im 17. Jahrhundert die Versteinerungen als bei dieser biblischen Naturkatastrophe ertrunkene Lebewesen. Der Rechtsprofessor Philipp Ernst Bertram (1726-1777) aus Halle/Saale meinte 1766, Gott habe Fossilien in den Boden gelegt - womöglich, um diejenigen zu prüfen, die an der göttlichen Schöpfung zweifelten. Und der Breslauer Mineraloge Karl Georg von Raumer (1783-1865) war 1819 felsenfest davon überzeugt, dass Fossilien verunglückte Probeschöpfungen der Natur seien.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Basilius Besler (1561-1628)
Alle diese frühen Forscher irrten. Aber das war kein Wunder, wenn man den kulturhistorischen Hintergund ihrer Zeit betrachtet. Noch anno 1650 war man sich allgemein einig, dass die Erde wenig mehr als 5500 Jahre alt sei. Der irische Erzbischof James Ussher (1581-1656) zum Beispiel hatte damals errechnet, die Schöpfung habe am 23. Oktober des Jahres 4004 vor Christi Geburt exakt um 9 Uhr begonnen.
Niemand zu Usshers Lebzeiten ahnte, dass die Reste von Pflanzen und Tieren in den Solnhofener Platten aus Bayern, die 1616 erstmals von dem Nürnberger Apotheker Basilius Besler (1561-1628) abgebildet wurden, etwa 150 Millionen Jahre alt sind. Die prächtigen Dendriten auf dem Solnhofener Kalkgestein wurden im 17. Jahrhundert als Moos gedeutet. In Wirklichkeit handelte es sich dabei um verästelte Kristallbildungen auf Schichtfugen und Kluftflächen, die aus eisen- und manganhaltigen Lösungen entstanden. Ihre Form ähnelte tatsächlich Moos, Sträuchern oder Bäumen. Außerdem beschrieb Besler eine „Spinne“, die hundert Jahre später als ein Meerestier entlarvt wurde, das mit Seesternen und -igeln verwandt ist. Völlig falsch beurteilt wurden auch Urweltfunde aus dem Rhein. Ein Wormser Bürger etwa meinte 1689: „Es ist unleugbar, dass große und mehr als 20 oder 30 Schuh lang gewesene Riesen und Drachen an dieser Rheingegend sich nicht selten aufgehalten haben, indem ein dergleichen Riesenbein anno 1635 im Rhein gefunden, ich selbstens zu Wormbs gehabt, nach welches abgeteilter Proportion der Mensch mehr als 30 Schuh lang müsste gewesen sein.“ Ein Schuh oder ein Fuß galt damals als Längenmaß von etwa 30 Zentimeter. Demnach wäre der
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dendriten wurden früher als Pflanzen fehlgedeutet.
Wormser Riese etwa neun Meter groß gewesen. Heute weiß man, dass es sich vermutlich um einen Mammutknochen handelte. Mancher stolze Entdecker von Fossilien (der Begriff stammt aus dem Lateinischen: fossilis = ausgegraben) erntete einst statt Anerkennung nur Hohn und Spott, wie beispielsweise der Londoner Apotheker Conyers, der 1715 nahe der britischen Hauptstadt im Kies eines längst ausgetrockneten Flusses einige Elefantenknochen und dicht daneben einen roh behauenen spitzen Stein fand. So etwas passte nicht in das damalige Weltbild. Deshalb wurde in den Kneipen viel über diesen Fall gewitzelt.
Unter anderem wurde gemutmaßt, es handle sich um einen ausgerissenen Zirkuselefanten, der jämmerlich umgekommen sei, weil ihm die britische Kost nicht bekam. Der Apotheker glaubte schließlich einem Freund, der die Elefantenknochen in die Zeit des römischen Kaisers Claudius (10 v. Chr.-54 n. Chr.) datierte, der Elefanten über den Kanal gebracht habe, um die Briten zu unterwerfen. Daraufhin wurden die Knochen und der Stein in ein Raritätenkabinett gebracht und als „Funde aus der Römerzeit“ bezeichnet.
Auch die Bedeutung der ersten dokumentarisch belegten Entdeckung von Dinosaurierspuren in Nordamerika wurde zunächst nicht erkannt. Als dem zwölfjährigen Farmersohn Pliny Moody (1790-1868) im Herbst 1802 dieser Fund glückte, war der Begriff Dinosaurier noch gar nicht bekannt, er wurde erst 1841 von dem Londoner Paläontologen Richard Owen (1804-1892) vorgeschlagen.
Pliny Moody hatte beim Pflügen eines Feldes unweit von South Hadley im US-Bundesstaat Massachusetts
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Herbst 1802 wurden
in South Hadley (Massachusetts)
die ersten Dinosaurierspuren Amerikas entdeckt, jedoch zunächst verkannt. einen umgestoßenen Felsbrocken erblickt, auf dem der Abdruck von drei riesigen Zehen zu erkennen war. Sie ähnelten Spuren von Vögeln, die über Schlamm oder Sand gelaufen waren. Die Menschen von South Hadley redeten viel über diesen sonderbaren Fund, bis einer von ihnen auf die Idee kam, es könne sich um Fußspuren jenes Raben handeln, den Noah nach der Sintflut ausgeschickt hatte, um trockenes Land zu suchen.
Weit von der Wahrheit entfernt war auch der englische Antiquar Edward Lluyd (1660-1709), der 1689 den ersten Fund eines Fischsauriers als „Lithophylacii Britannici ichnographia“ bezeichnete. Lluyd hielt den Fischsaurier, der vom Aussehen her heutigen Delphinen ähnelte, für einen Fisch besonderer Art. Er meinte, wenn das Meerwasser verdunstet, dann gerieten auch Fischeier in die Wolken und würden später mit dem Regen auf das Festland fallen. In den trockenen Erdschichten, so erklärte er, würden sich aus ihnen keine normalen Fische entwickeln, sondern solche aus Stein. Alle Fossilien wären nach dieser Deutung keine Lebewesen aus Fleisch und Blut, sondern seltene Naturspiele, zusammengebacken aus Rogen, Samenluft und von Meeresdünsten imprägniertem Gestein.
Über diese Theorie lächelte einige Jahrzehnte später ein anderer Entdecker eines Fischsauriers, nämlich der Zürcher Stadtarzt und Chorherr Johann Jakob Scheuchzer (16721733) - doch heute schmunzelt man auch über ihn. Scheuchzer erklärte nämlich allen Ernstes, mehrere unter dem Galgenberg der fränkischen Stadt Altdorf geborgene Wirbel gehörten zum Beingerüst eines verruchten Menschenkindes aus der Sintflut, um dessen Sünde willen das Unglück über die Welt hereingebrochen sei. Ähnlich äußerte er
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) hielt fossile Tierreste
für Knochen in der Sintflut ertrunkener Menschen.
Johann Jacob Baier (1677-1735) hielt Ichthyosaurierknochen
irrtümlich für Fischwirbel,
Porträt von Georg Martin Preißler (1700-1754)
20 Riesen
Bild auf Seite 21:
Flugblatt des Zürcher Stadtarztes und Chorherrn Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733)
um 1726 mit der ältesten Darstellung eines fossilen Riesensalamanders aus Öhningen am Bodensee. Scheuchzer verkannte diesen Fund
als Gebeine eines in der Sintflut
ertrunkenenen Menschen (Homo diluvii testis).
sich 1726 über fossile Reste eines Riesensalamanders aus den tertiären Süßwasserablagerungen von Öhningen am Bodensee.
Um 1712 wies der Altdorfer Arzt und Mineraloge Johann Jacob Baier (1677-1735), der die Gesteinsbildungen und Fossilien der Jurazeit in Ober- und Mittelfranken untersuchte, zu Scheuchzers großem Ärger nach, dass solche gehöhlten Wirbelpaare nie und nimmer den Körper eines Menschen getragen haben konnten. Baier bestimmte die Ichthyosaurierkochen als Fischwirbel.
Allmählich zogen immer mehr Paläontologen die richtigen Schlüsse über die Fossilien. Sie verglichen die Knochen mit heute lebenden Tieren und kamen vielfach zu immer noch gültigen Erkenntnissen. Schließlich bot die Evolutionstheorie von Charles Darwin (1809-1882) gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts den theoretischen Hintergrund für die korrekte Interpretation der Fossilienfunde. Vor Irrtümern sind die Paläontologen freilich auch heute noch nicht völlig gefeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Monströse Gestalten
aus der „Cosmographia“ (1544) von Sebastian Münster (1488-1552), von links nach rechts:
Einfüßer (Monopod oder Sciapod), weiblicher Kyklop,
zusammengewachsene Zwillinge, kopfloser Blemmyer
und Werwolf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
David und Goliath, Lithographie von
Osmar Schindler (1869-1927)
Riesen 25
Manches Monster war ein Mammut
Worauf viele Riesensagen beruhen
David rannte auf den Philister zu, schwang seine Schleuder und ließ Goliath einen Stein gegen die Stirn flie- gen, die der Helm nicht bedeckte. Goliath stürzte und fiel aufs Gesicht. Auf diesen Moment hatte David gewartet. Er lief zu seinem niedergestreckten Feind, zogdessen Schwert und schlug ihm den Kopf ab.
Diese Geschichte aus dem „Alten Testament“ ist nur eine der vielen Erzählungen darüber, wie ein normal gewachsener Mann einen Riesen mit List bezwingen konnte. Goliath erreichte angeblich dreieinhalb Meter Höhe, und sein Panzerhemd soll sage und schreibe 104 Kilogramm gewogen haben. Welch großer Held muss also der kleine David gewesen sein, der einst jenen furchterregenden Krieger zu Boden streckte?
Riesen verkörperten über Jahrtausende hinweg das Bild des mächtigen und kraftvollen „Supermannes“. Nicht wenige Kulturen schrieben ihnen die Erschaffung der Erde zu, denn „primitive Völker“ konnten sich nicht vorstellen, dass jemand anders als Riesen gigantische Ozeane, hohe Gebirge und tiefe Schluchten mit ihren Händen zu formen vermochten. Auch verheerende Stürme und wolkenbruchartige Re-
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„The Colossus“, Gravierung von
Francisco de Goya (1746-1828), entstanden zwischen 1810 und 1818
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Illustration aus „Around the Moon“ von Jules Verne (1828-1905),
Zeichnung von Émile Bayard (1837-1891) und Alphonse de Neuville (1835-1885)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Berggeist Rübezahl.
Ölgemälde von Moritz von Schwind (1804-1871) von 1859,
Original in der Schack-Galerie, München
genfälle wurden als das Werk göttlicher Riesen gedeutet, die an ihre Macht erinnern wollten.
Der englische Volksmund beispielsweise kennt viele phantasievolle Erzählungen über die Entstehung von Hügeln, Tälern und anderen Landschaftsformen durch Riesenhand. So sollen Riesen oft Erdhügel umhergeworfen oder gewaltige Felsbrocken ins Meer geschleudert haben. Die Angelsachsen erwähnten in ihren Gedichten häufig Riesen, die vor ihrer Ankunft in England existiert haben sollen. Sie konnten es sich nicht vorstellen, dass die von den Römern errichteten imposanten Bauwerke - wie Tempel, Festungen und Äquadukte - von normalgewachsenen Menschen geschaffen wurden.
Auch die Deutschen hatten ihre Riesen. Man denke nur an den Berggeist Rübezahl des Riesengebirges, der nach der Sage in vielerlei Gestalt den Wanderern half und sich an Spöttern rächte. Oder an die vielen Riesen, die in Rheinsagen eine Rolle spielten. So soll ein Riese namens Tännchel die Felsen gesprengt haben, die das Wasser des Rheins zwischen Schwarzwald und Vogesen aufstauten. Und den letzten Riesen aus dem Odenwald hat angeblich Kaiser Maximilian (1459-1519), genannt der letzte Ritter, höchstpersönlich bei einem mittelalterlichen Turnier in Worms am Rhein besiegt.
Im Schwank erwiesen sich Riesen oft als ungeschlachte Tölpel, die auf vielfältige Weise überlistet wurden. Offenbar benutzten Menschen die Riesenlegenden gern zur Erklärung vieler Naturphänomene und um ein unbewusstes Verlangen nach übermenschlicher Fähigkeit auszudrücken. Nachdem unsere Vorfahren diese scheußlichen Ungeheuer ersonnen hatten, fanden sie stets auch
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Kyklop Polyphem,
Gemälde von Annibale Carracci (1560 - 1609),
Original im
Palazzo Farnese, Rom
Mittel und Wege sie durch Klugheit und allerlei Listen zu besiegen.
Die Gestalt der Riesen ist wahrscheinlich aus vielerlei urtümlichen Vorstellungsbereichen erwachsen: aufgrund existierender stark unterschiedlicher Größenverhältnisse, wegen der Deutung außerordentlicher Naturerscheinungen als Wirkung überstarker Wesen, durch Proportionsphantasie (der unterlegene Gegner muss aus Gründen des Effekts zu übermenschlichen Proportionen gesteigert werden, solche Vorstellungen spielten auch bei Drachensagen eine Rolle), vielleicht aber zudem durch Halluzinationen im Rauschzustand.
Wie dem auch sei - Vorstellungen von riesigen Wesen finden sich seit ältester Zeit und überall auf der Erde. Die Griechen der Antike sahen in den Titanen, Giganten, Kyklopen und Hekatoncheiren die Naturkräfte verkörpert. Als das älteste Göttergeschlecht galten die Titanen. Bei den Giganten (Gigantes) handelte es sich um Mischwesen aus Menschen und Schlangen, die Gegner der olympischen Götter waren. Die Kyklopen (Zyklopen oder Zyklopes) besaßen nur ein einziges Auge. Der Begriff Kyklopenmauer für unregelmäßige, großformative Steinverbünde beruht auf ihnen. Kyklopen sollen auch die Erbauer der Burgmauern von Tiryns und Mykene gewesen sein. Von den Kyklopen wurden Blitze und Donnerkeile für den Göttervater Zeus geschmiedet. Unter dem Begriff Hekatoncheiren versteht man mehrarmige Riesen, von denen die größten angeblich jeweils 50 Köpfe und 100 Arme besaßen. Der Riese Geryones hatte drei Körper und die schönsten Rinder der Welt sein eigen. Geryones und sein Hirte Euryion starben durch Herakles. Eine Berühmtheit ist auch der Bronzeriese Talos, den Zeus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der junge Hebräer David zeigt den Kopf des besiegten Philisters Goliath,
Illustration von Gustave Doré (1832-1883)
erschuf, um seine Geliebte Europa zu beschützen. Talos wurde von den Argonauten bezwungen.
In der Bibel, genauer gesagt im „Alten Testament“, ist öfter von Riesen die Rede. Im 1. Buch Mose vor der SintflutErzählung heißt es, die Riesen seien entstanden, nachdem die „Gottessöhne“ sich die Töchter der Menschen zu Frauen genommen und sich mit ihnen gepaart hätten. Die aus diesen Beziehungen stammenden Kinder sollen den Grundstock für das Volk der Riesen gelegt haben. Jenes in seinem Kern böse Riesenvolk namens Nephilim soll durch die Sintflut vernichtet worden sein.
Von Riesen berichteten auch Kundschafter, die von den in der Wüste befindlichen Israeliten unter Moses ausgesandt wurden. Die Kundschafter sollten das gelobte Land nördlich des Sinai, „in dem Milch und Honig fließen“, erkunden. Teile der dortigen Einwohner hat man als Riesen sowie als Söhne Anaks und später als Anikiter bezeichnet. Ein weiteres Riesenvolk namens Emiter soll im Land Moab existiert haben. Bei Eroberungen in der Folgezeit wurde in Baschan („Land der Riesen“) der König und letzte Riese Og besiegt. Der steinerne Sarg von Og soll mindestens drei bis viereinhalb Meter lang gewesen sein. Mehr bekannt als diese Ereignisse ist der Kampf des knabenhaften David gegen den Riesen Goliath, der einem Volk von Riesen angehört haben soll. Als Riese oder zumindest riesenhafter Mensch mit erstaunlicher Kraft wird Samson (Simson), einer der Richter Israels, bezeichnet. Er verlor seine Kraft, als ihm seine Geliebte, die Philisterin Delila, heimtückisch die Haare schor. Nun konnten ihn die Philister überwältigen und blenden. Nachdem die Haare von Samson wieder gewachsen waren, rächte sich Samson an den Philistern.
[...]