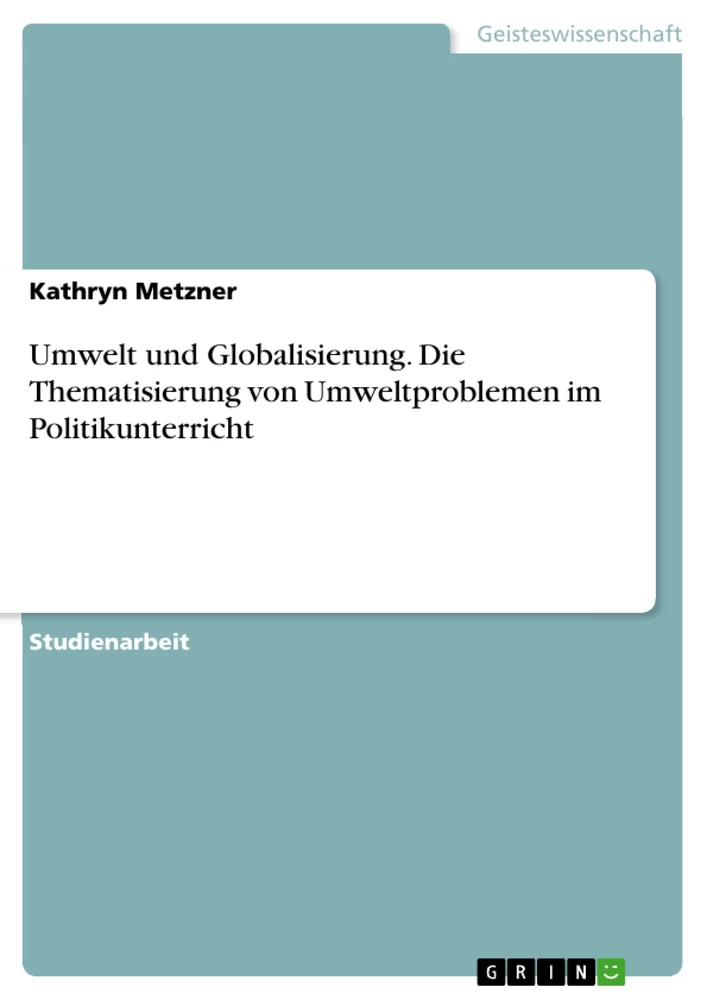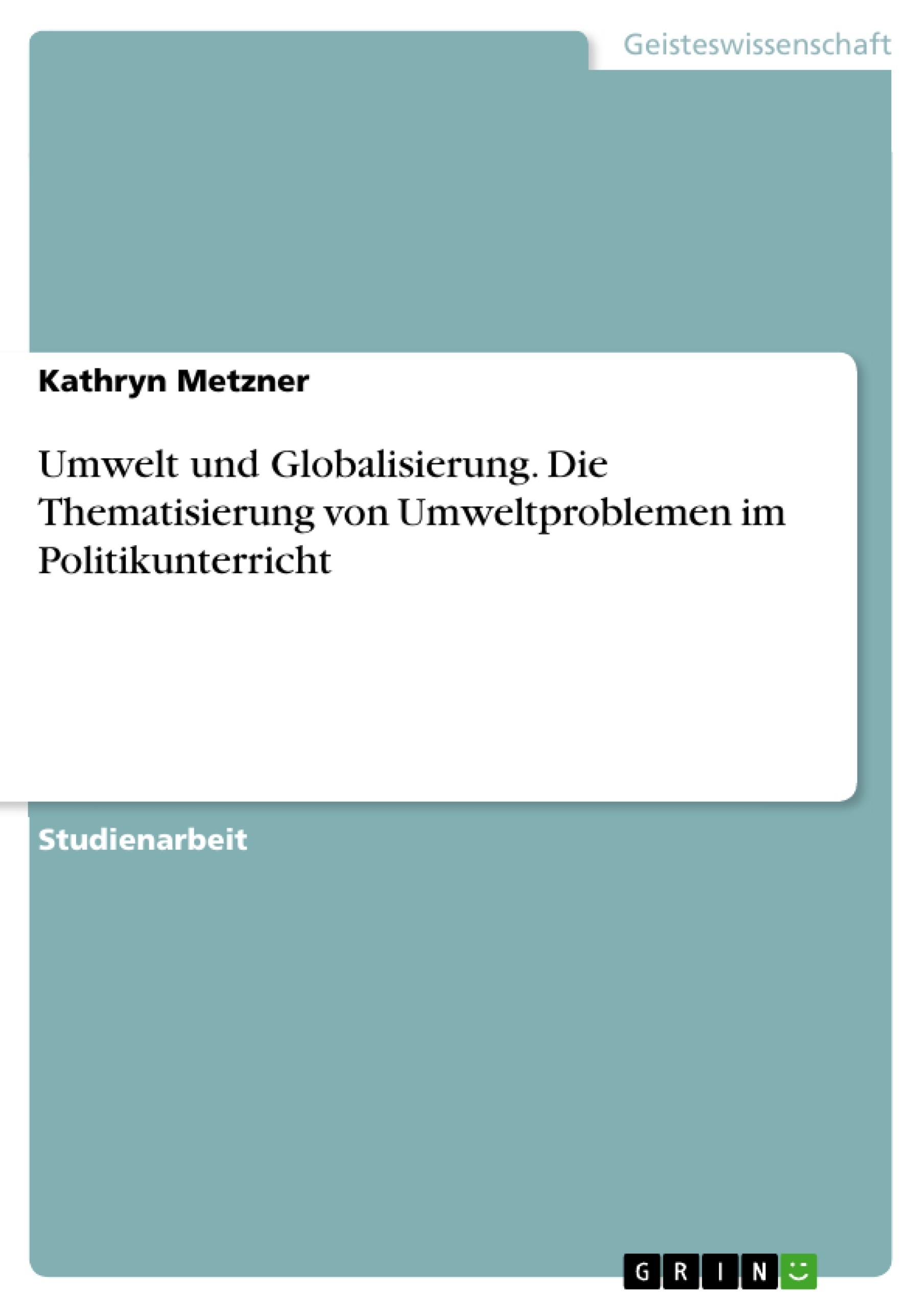In dieser Arbeit soll sich mit dem Zusammenhang zwischen der Umwelt und der Globalisierung beschäftigt werden. Es stellt sich die Frage, welche globalen Umweltprobleme es gibt und wie sich diese im Politikunterricht, wie auch in anderen Fächern thematisieren lassen.
In dem ersten Abschnitt soll geklärt werden, wodurch diese Umweltprobleme entstehen und welche globalen Umweltprobleme zu verzeichnen sind. Dafür werden zuerst die Gründe für globale Umweltveränderungen genannt. In einem weiteren Schritt werden zwei wichtige Umweltveränderungen erläutert: der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität. Somit wird in dem ersten Abschnitt der Frage nachgegangen, welche globalen Umweltprobleme bestehen.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den zweiten Teil, indem das Thema globale Umweltveränderung im Politikunterricht erläutert wird. Es stellt sich die Frage, wie das Thema behandelt werden kann und ob der Lehrplan dieses überhaupt vorsieht. Zudem soll geklärt werden, ob Umweltprobleme alleine auf den Politikunterricht zu beschränken sind, oder ob dieses in andere Fächer miteinbezogen werden kann.
Darauf folgt eine eigens ausgedachte Unterrichtsidee, welche sowohl im Politikunterricht, wie auch im Biologieunterricht eingesetzt werden kann. Zum Schluss wird aus den gewonnenen Erkenntnissen ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Globale Umweltveränderungen
2.1 Gründe für globale Umweltveränderungen
2.2 Klimawandel
2.3 Verlust an Biodiversität
3. Das Thema globale Umweltveränderung im Politikunterricht
3.1 Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
3.2 Das Thema Umwelt und Globalisierung im Lehrplan
3.2.1 Umsetzung im Politikunterricht
3.2.2 In anderen Fächern
4. Eigene Unterrichtsidee
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
7. Quellenverzeichnis