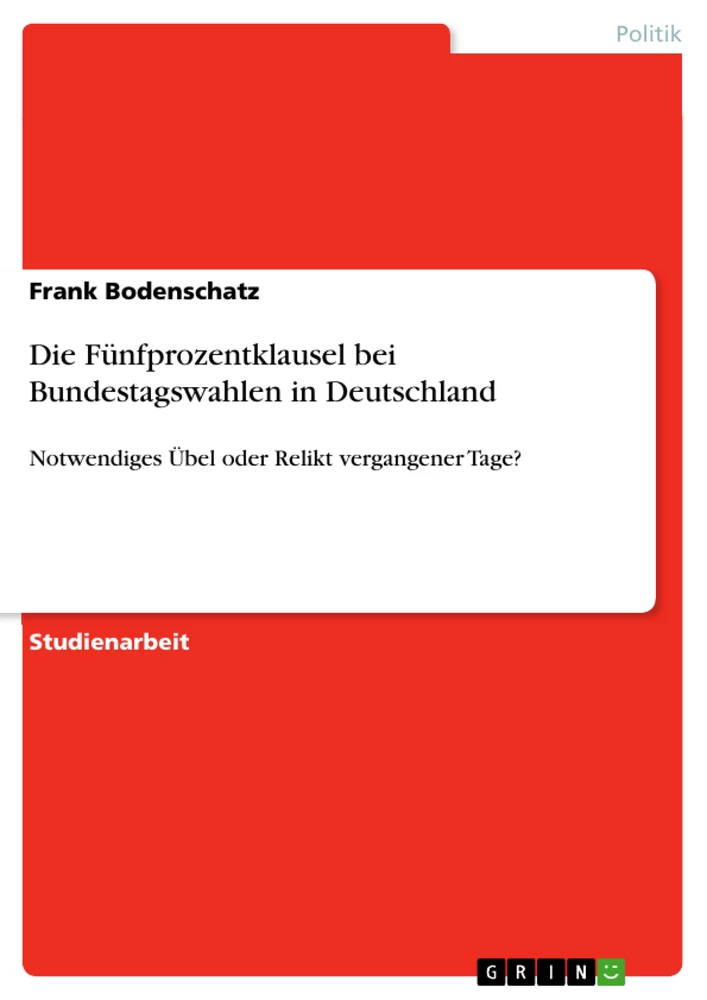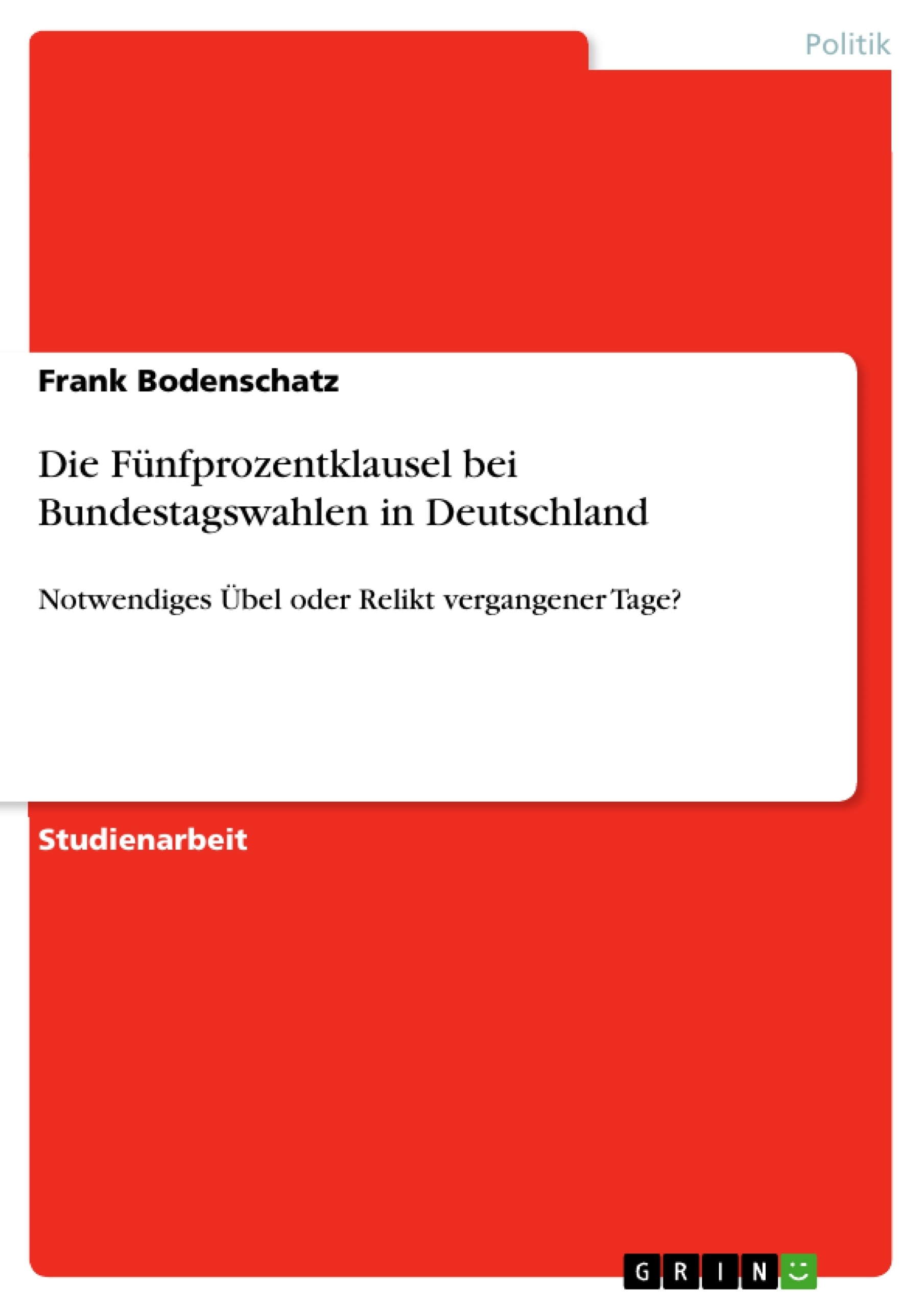Die Fünfprozentklausel, eine der so genannten Sperrklauseln bei Bundestagswahlen, hat sich seit ihrer Einführung und Modifizierung in den Anfangsjahren der Bundesrepublik als technisches Element der Ausgestaltung unseres personifizierten Verhältniswahlsystems behauptet und ist den meisten Bürgern vertraut. Doch obwohl sie seit Generationen zur wahlrechtlichen Normalität gehört und aufgrund der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts weitestgehend akzeptiert bzw. nur sporadisch hinterfragt wird, stellt diese Regelung eine gravierende Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes bei der Stimmabgabe dar. Das Repräsentationsziel der Verhältniswahl, nämlich Proportionalität, wird durch den Ausschluss bestimmter Parteien von der Mandatsvergabe nicht vollständig erreicht, zudem gehen hunderttausende Wählerstimmen „verloren“. Zwar hat jede Stimme den gleichen Zählwert, doch eine Erfolgswertgleichheit ist nicht garantiert. Das sich daraus ergebende Gerechtigkeitsproblem wird zugunsten vereinfachter Koalitionsbildungen und einer vermeintlichen Regierungsstabilität billigend in Kauf genommen.
Aber ist die Fünfprozentklausel wirklich noch zeitgemäß? Wie steht es allgemein um ihre Legitimität? Gibt es realistische Alternativen, die im Grundsatz ihrer Intention entsprechen und dennoch im Stande sind, die negativen Effekte (eingeschränkte Repräsentation, unzureichende Partizipation) aufzulösen? Wie kann das Gerechtigkeitsproblem behoben oder zumindest entschärft werden? Das sind die Leitfragen, an denen sich diese Untersuchung orientieren wird, mit dem Ziel, Perspektiven für eine Reformierung des Wahlrechts aufzuzeigen, die der beschriebenen Problematik in angemessener Weise begegnet.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau
1.3 Forschungsstand
2 Theoretische Vorüberlegungen
2.1 Sperrklauseln als technisches Element von Wahlsystemen
2.2 Rechtliche Grundlage für Sperrklauseln in Deutschland
2.3 Historische Entwicklung der Sperrklauseln in Deutschland
3 Auswirkungen und Bewertungen der Fünfprozentklausel
3.1 Die Argumentation der Befürworter
3.2 Überlegungen der Kritiker
3.3 Beeinflussung des Wahlverhaltens
3.4 Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
4 Abschaffung oder Reformierung? – Plädoyer für eine „sanfte Entschärfung“
4.1 Mögliche Alternativen und ihre Probleme
4.2 Warum die Fünfprozentklausel nicht mehr zeitgemäß ist
4.3 Warum Sperrklauseln dennoch unverzichtbar erscheinen
5 Schlussbetrachtung
5.1 Fazit
5.2 Ausblick
6 Quellen