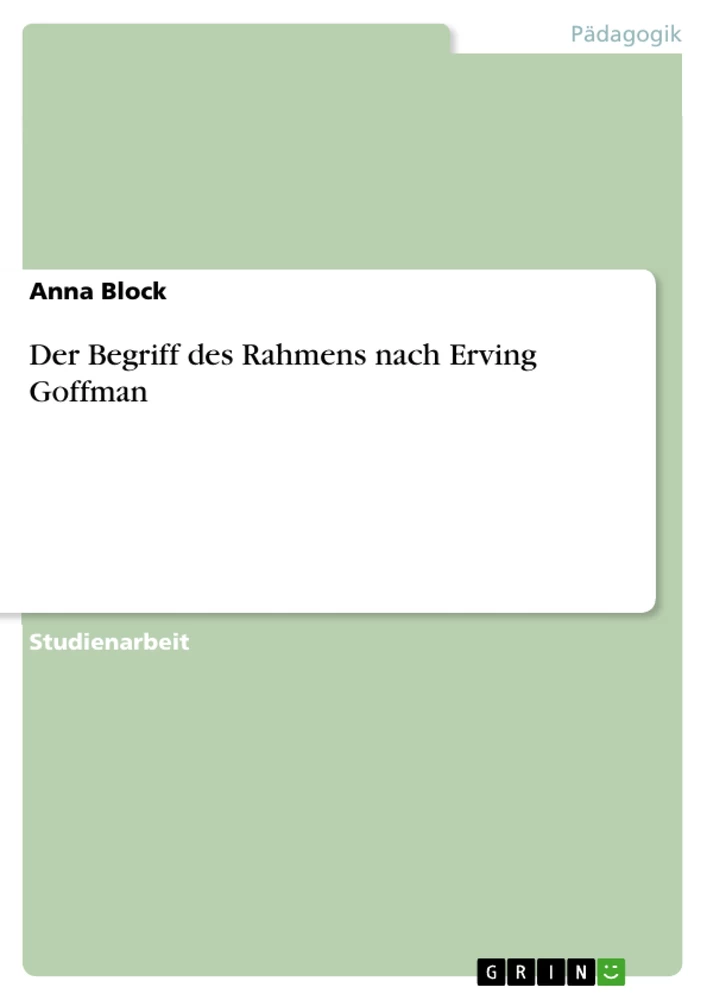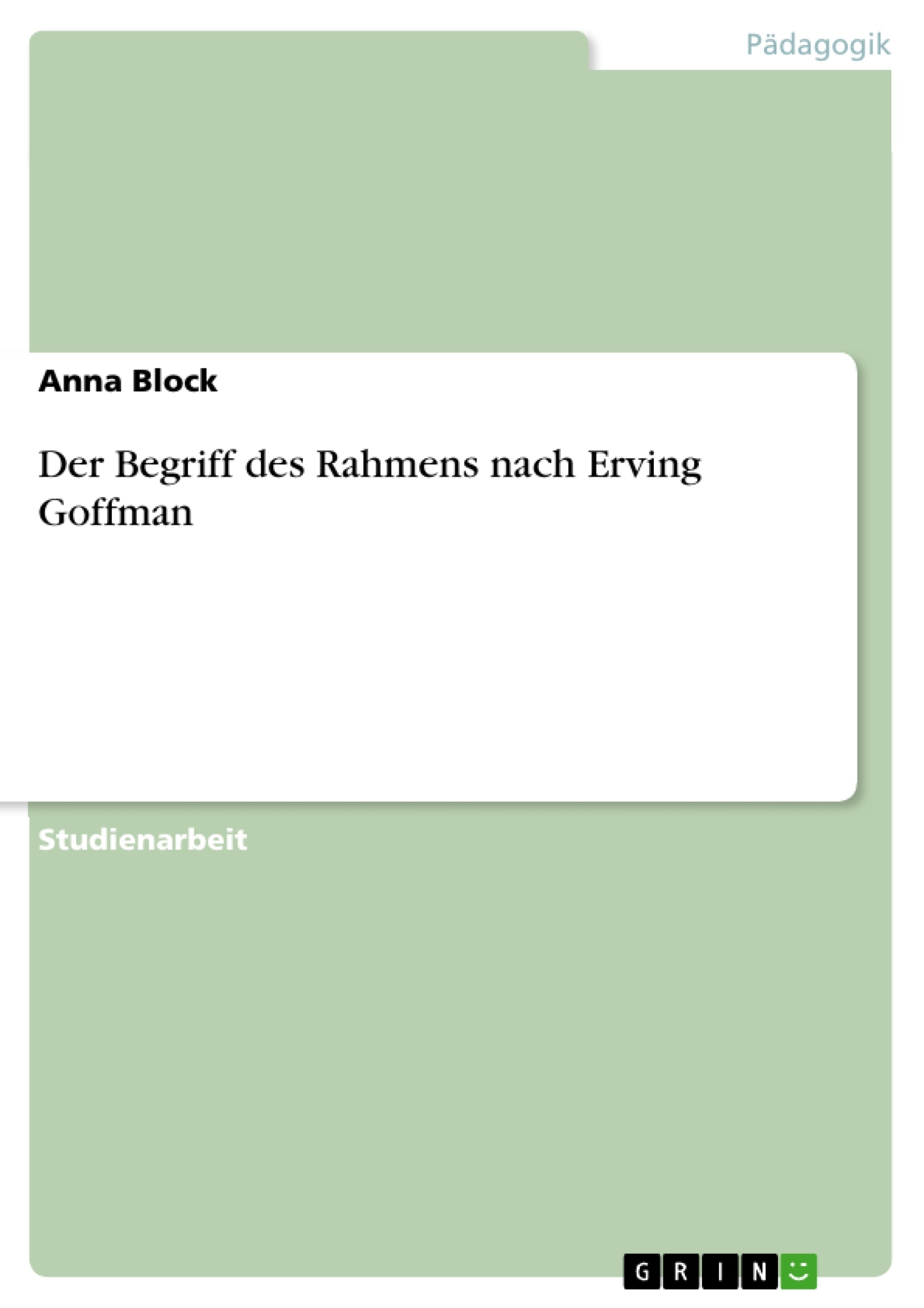Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff des Rahmens, mit dem Ziel aufzuzeigen, was Goffman mit diesem Begriff spezifisch meint und welche Funktionen ihm innewohnen.
Zu diesem Zweck wird in Kapitel 2 die begriffliche Differenz zwischen Rahmen und Rahmung vorangestellt wird, um im dritten Kapitel die primären Rahmen näher beleuchten zu können. Diese werden in zwei Kategorien unterteilt, womit sich das vierte Kapitel beschäftigen wird. Zudem dienen primäre Rahmen als Ausgangsmaterial für mannigfaltige Sinntransformationen. Goffmans Ziel ist es, Regeln anzugeben, nach denen primäre Rahmen in etwas anderes transformiert werden. Aus diesem Grund findet in Kapitel 5 eine Beschäftigung mit den Begriffen der Modulation und der Täuschung statt.
Letztendlich untersucht Goffman soziale Interaktionen mit einer Neugier auf das, was sich hinter der Maske tut. Dafür führt er die Begriffe der Vorder- und Hinterbühne ein, die in Kapitel 6 näher betrachtet werden sollen, bevor in Form eines abschließenden Resümees die Rahmentheorie Goffmans komprimiert dargestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Rahmen und Rahmung
3. Primäre Rahmen
4. Soziale und natürliche Rahmen
5. Modulation und Täuschung
6. Bühnen
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis