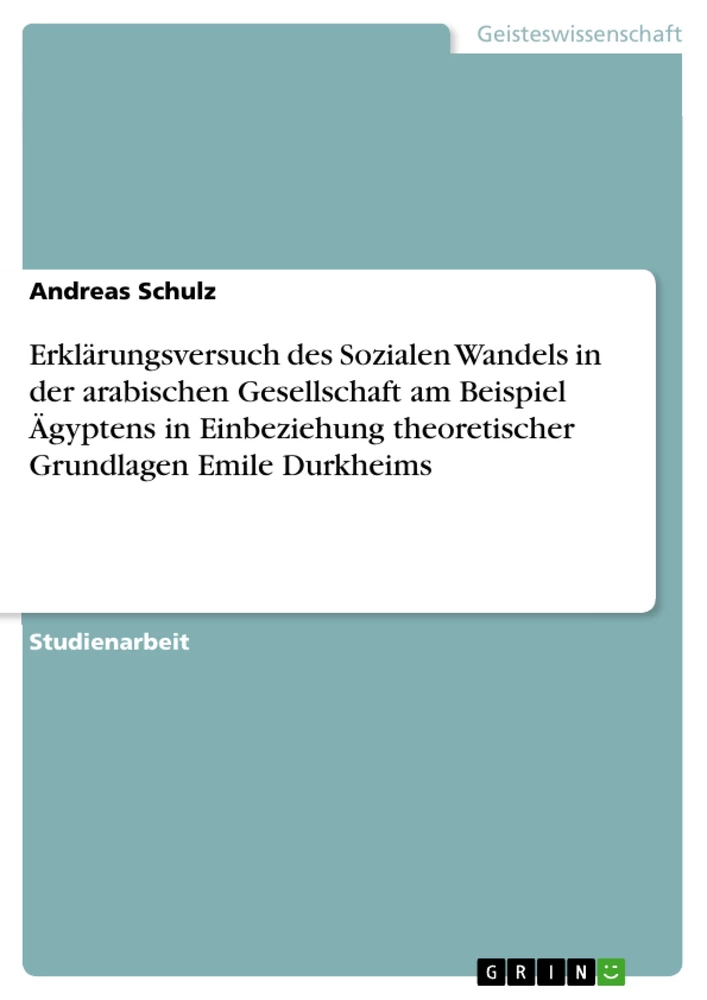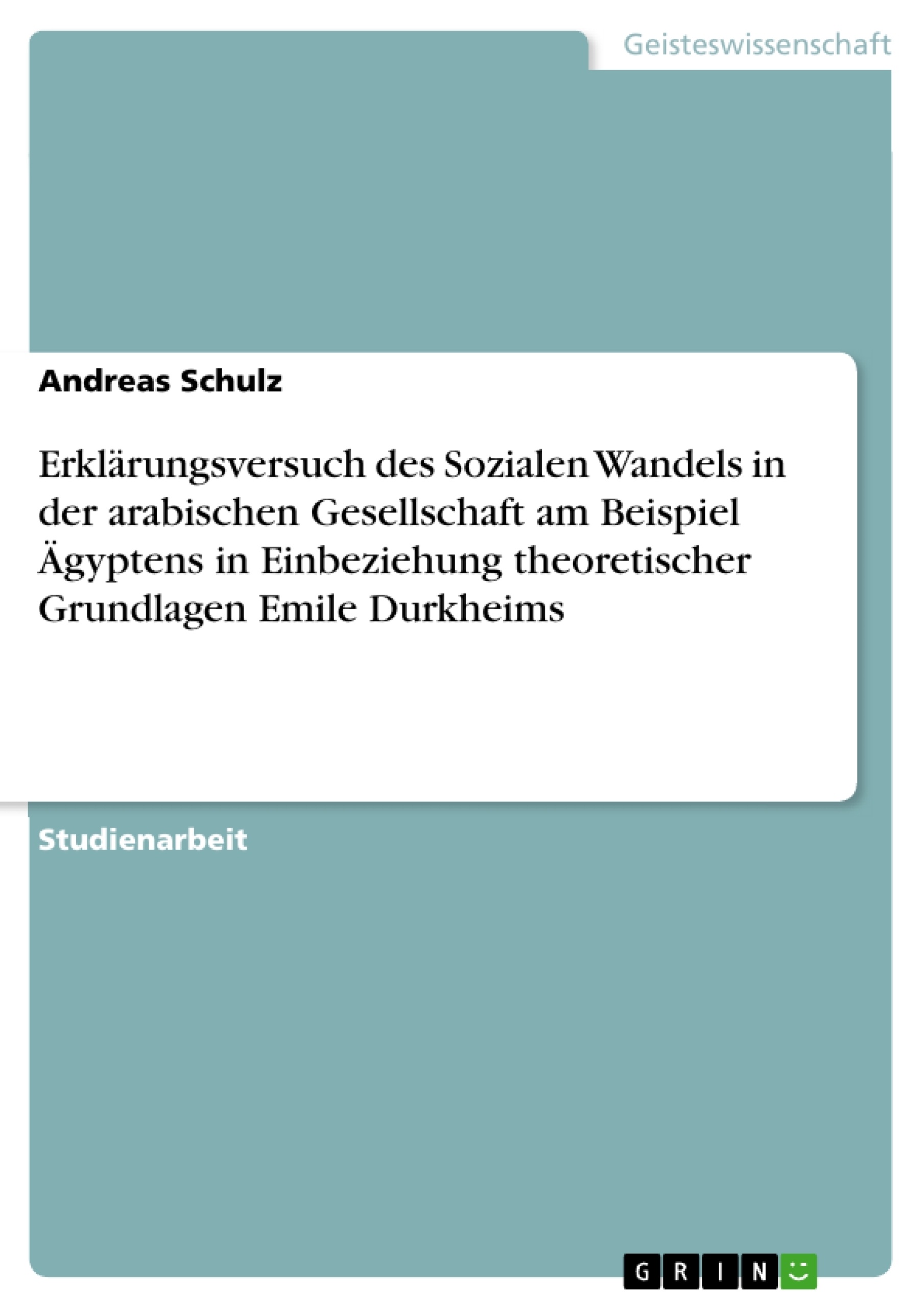Die arabisch-islamische Welt ist im Umbruch. Beginnend mit der „Jasmin-Revolution“ 2010 in Tunesien über Proteste in Ägypten, Syrien, Jemen und Libyen und Teilen der restlichen arabisch-islamischen Staaten. Die Proteste im sogenannten „Arabischen Frühling“ richten sich gegen die alten Strukturen und die autokratische Politik der autoritären Herrscher. Politiker wie der ehemalige ägyptische Präsident Husni Muhammad Mubarak und seine Regierung führten über Jahre einen politischen Kurs, dessen Grundzüge sich im Wesentlichen nicht veränderten. Weder Zeitpunkt noch Auslöser der Revolutionen waren vorhersehbar, da bereits seit Jahrzehnten diese politischen Zustände herrschten, die jetzt zur Auflehnung der Menschen führten (Özturk 2011: 2). Die Menschen forderten die Absetzung des Präsidenten und seiner Regierung und damit auch den Wandel (Bamyeh 2011: 3). Wie kam es jedoch zu einer so breiten spontanen Solidarisierung der Protestler, die fast alle Bevölkerungsschichten erfasste? Anhand späterer soziologischer Theorien wie die der Symbolisierung aus den „Elementaren Formen des religiösen Lebens“ des französischen Soziologen Emile Durkheims, soll versucht werden, den sozialen Wandel im andauernden „Arabischen Frühling“ am Beispiel Ägyptens zu erklären. Hierfür wurde zum einen auf massenmediale Internetberichterstattung wie beispielsweise „Zeit.de“ oder „Süddeutsche.de“, aber auch auf staatliche Online-Berichterstattung wie das vom Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellte Informationsmaterial zu den Ereignissen in Ägypten 2011 zurückgegriffen, um die Geschehnisse der Revolution zu skizzieren. Zuerst sollen einige theoretische Ideen sowie das für diese Arbeit relevante basale Grundverständnis Emile Durkheims vorgestellt werden.
Gliederung
Einführung
Theorie und Hypothesen
Hinführende Gedanken zur politischen und sozialen Situation Ägyptens
Husni Mohammad Mubarak
Die Analyse
Fazit
Quellen