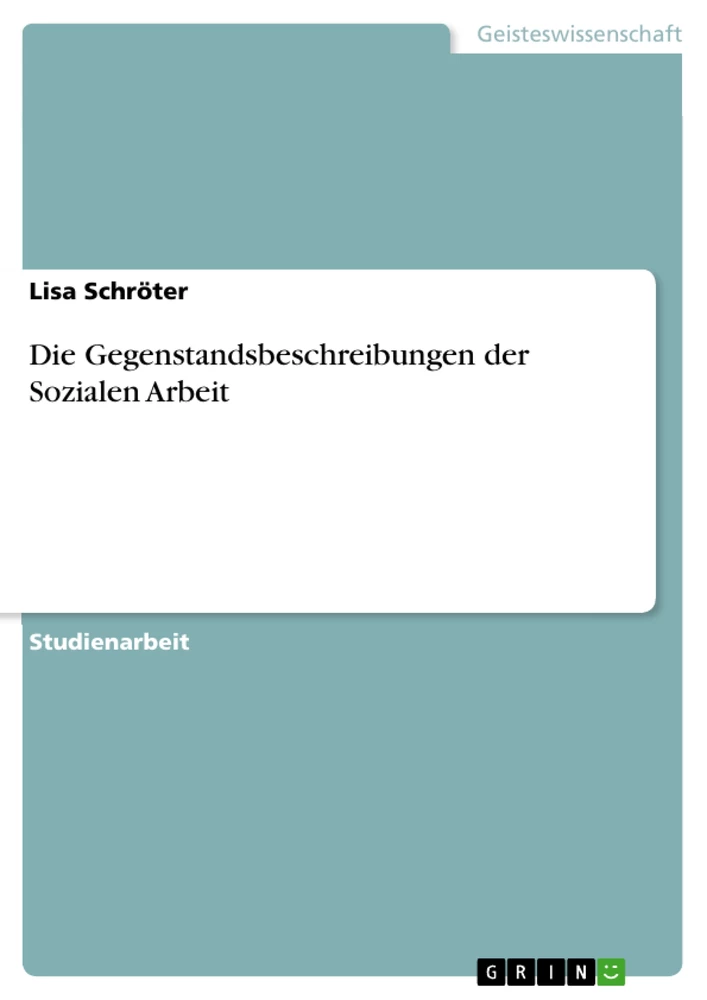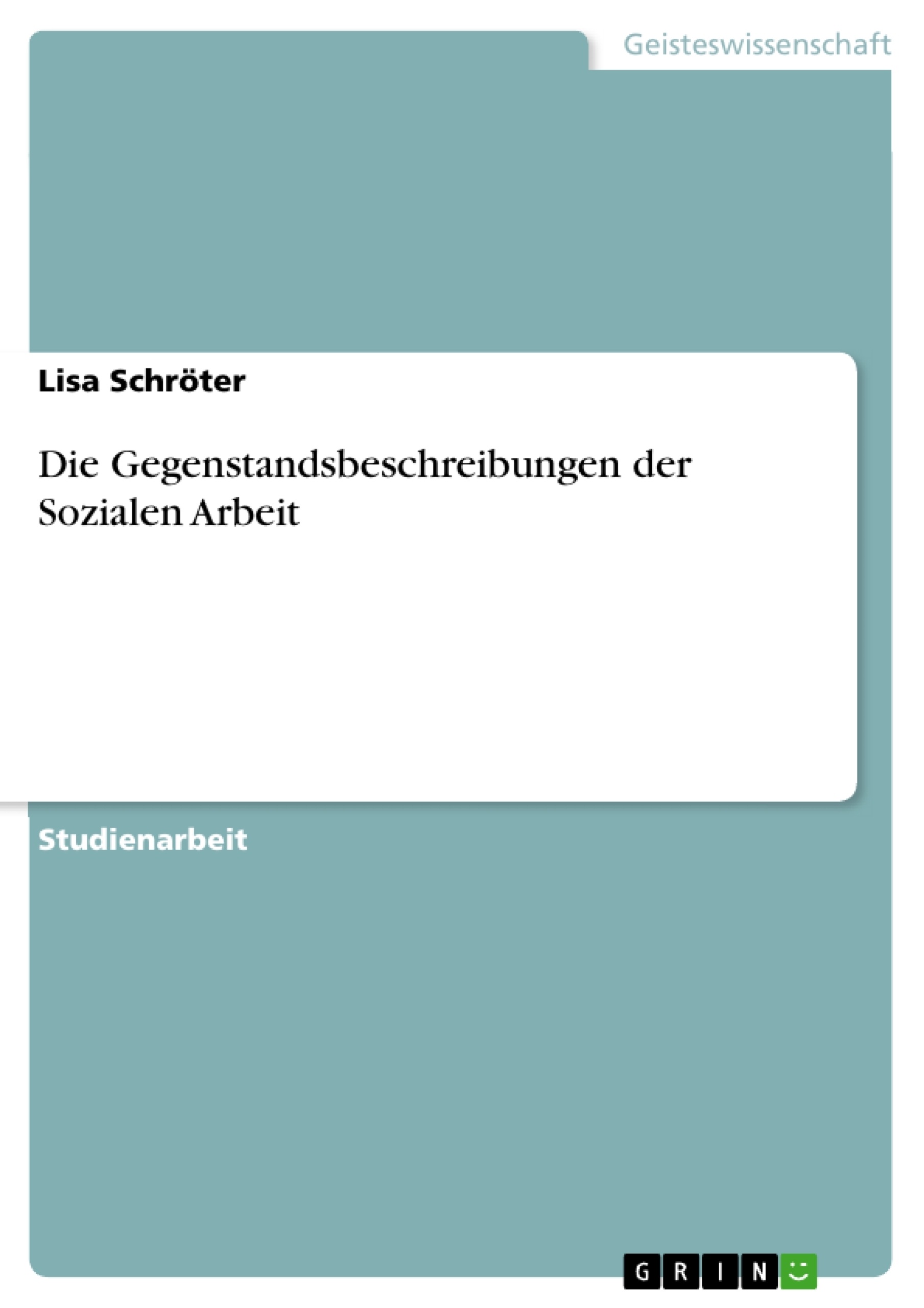Eine Erläuterung sowie ein kommentierender Vergleich der 4 großen Gegenstandsbeschreibnungen der Sozialen Arbeit.
- Soziale Arbeit als Inklusionsvermittlung, Exklusionsvermeidung,und Exklusionsverwaltung
- Soziale Arbeit als Bearbeitung sozialer Probleme (Menschenrechtsprofession)
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- Soziale Arbeit als Dienstleistung
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Soziale Arbeit als Inklusionsvermittlung, Exklusionsvermeidung, und Exklusionsverwaltung
2.1 Soziale Arbeit als Bearbeitung sozialer Probleme
2.2 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
2.3 Soziale Arbeit als Dienstleistung
3 Vergleich der Theorien
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis