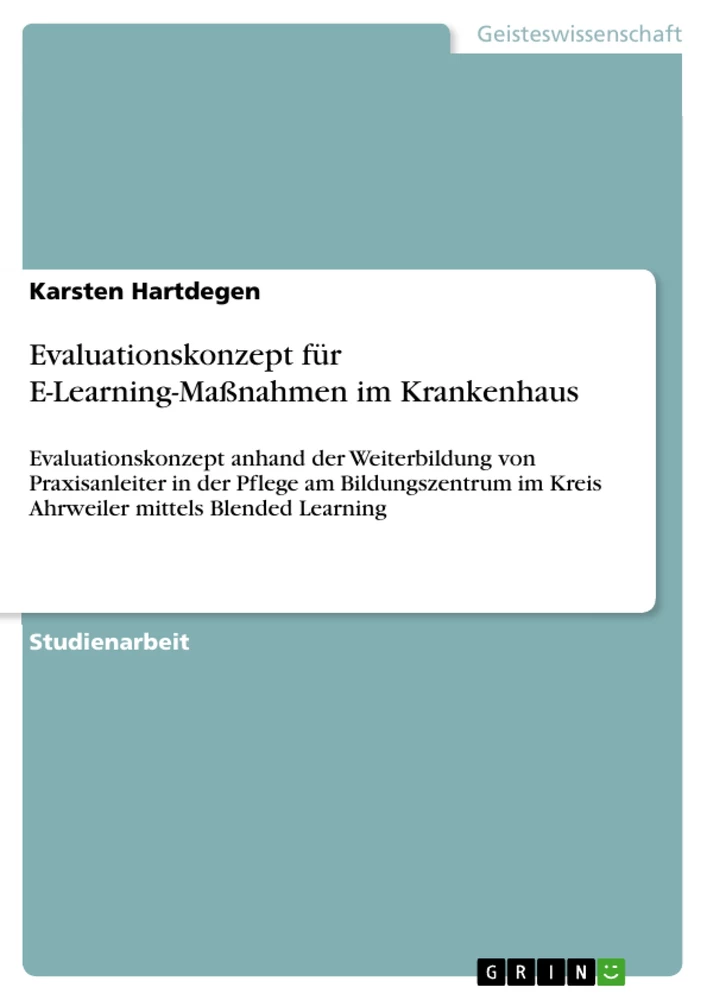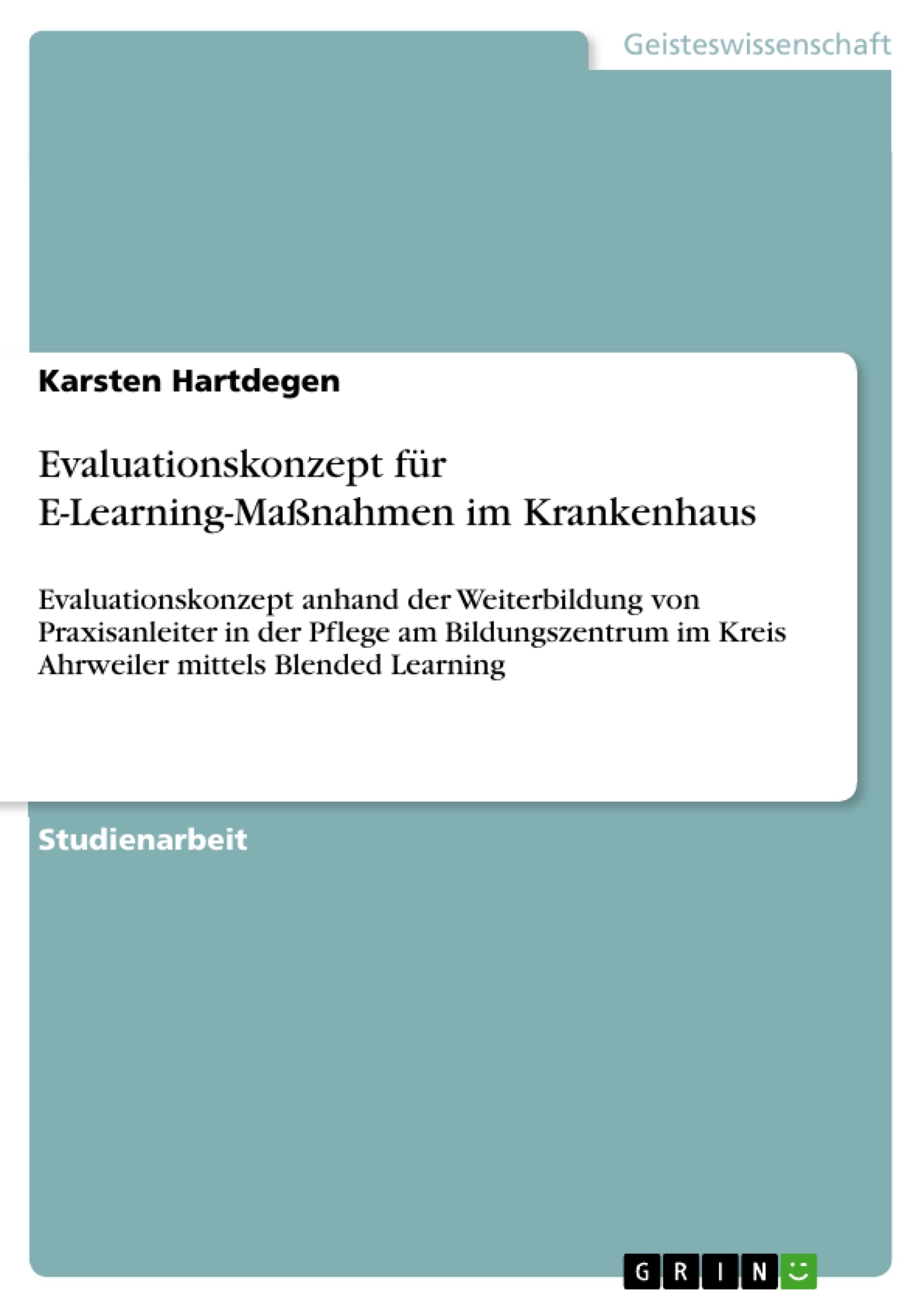Im Gesundheitssystem ist durch die stetige wissenschaftliche Weiterentwicklung der Medizin und Pflege und aufgrund des technischen Fortschritts ein so großer Fort- und Weiterbildungsbedarf wie in kaum einem anderen Bereich vorhanden (Erbe, 2010; Boucsein, 2010; Renken-Olthoff, 2010; Großkopf 2010).
Die Einführung der mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 initiierten DRGs als reines Vergütungs- und Entgeltsystem führte zwangsläufig zu einer Verstärkung des innerbetrieblichen Controllings und zu einer multiprofessionellen Prozesssteuerung durch Einführung von Clinical Pathways und Case Management. Um als Krankenhausbetrieb überleben zu können, müssen sektorenübergreifende Kooperationen und Versorgungsstrukturen eingerichtet sein, was bei Pflegekräften zu einer umfassenden Veränderung der Rahmenbedingungen ihrer Arbeit einschließlich der Arbeitsabläufe und der organisatorischen Strukturen führt (Reinhardt, 2006, S. 34f.; Bohnes et al., 2008, S. 218; Westermann, 2008, S. 244f.).
Die zentralen Herausforderungen für eine aktivierende Gesundheitspolitik bestehen deshalb darin, sowohl Qualität als auch Effizienz zu erhöhen (MFJFG, 2000, S. 66 ff.; Stempel, 2010).
Aus diesen Gründen entsteht nicht nur ein hoher Bedarf an gut aus-, fort- und weitergebildeten Ärzten, sondern auch an entsprechend gut ausgebildeten Pflegekräften, welche diese Strukturveränderungen und Kostenreduzierungen umsetzen müssen. Der Bedarf an einer kostengünstigen, effizienten und effektiven Weiter-bildung spielt in diesem Kontext eine große Rolle (Pflege heute, 2007, S. 47 f.).
In dieser Hausarbeit möchte ich die Möglichkeiten des Qualitätsmanagements und der Evaluation von Lernerfolg von Corporate E-Learning in der Fort- und Weiterbildung im Krankenhaus aufzeigen und anhand der Maßnahme zur Weiterbildung von Gesundheits- und Krankenpfleger zum Praxisanleiter in der Pflege am Bildungszentrum im Kreis Ahrweiler verdeutlichen. In diesem Kontext werde ich ein passendes Evaluationskonzept vorstellen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Allgemeine Analyse der Ausgangslage im Gesundheitssystem, an Krankenhäusern und in der Weiterbildung von Pflegefachkräften
3. Ausgangslage E-Learning in Krankenhäusern
4. Qualitätsmanagement
4.1 Definition des Begriffs Qualität
4.2 QM im Krankenhaus nach EFQM® und KTQ®
4.2.1 EFQM®
4.2.2 KTQ®
4.3 QM von Bildungsmaßnahmen
4.4 QM von E-Learning
5. Evaluation der Lernqualität von Bildungsmaßnahmen
6. Evaluation des Blended Learning Konzeptes am Bildungszentrum im Kreis Ahrweiler
7. Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis