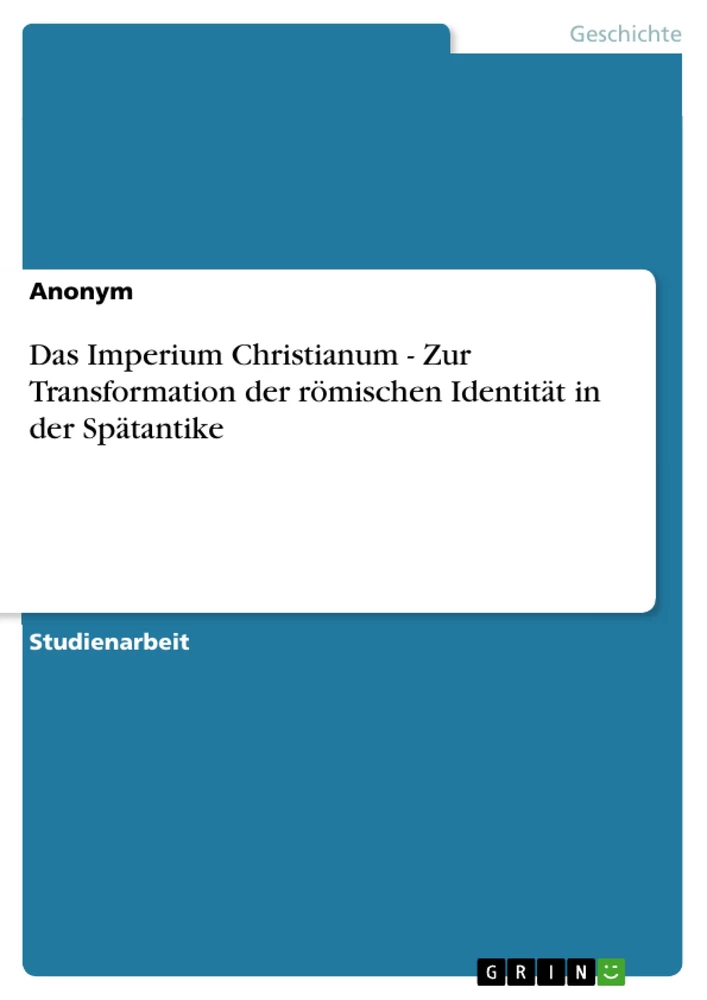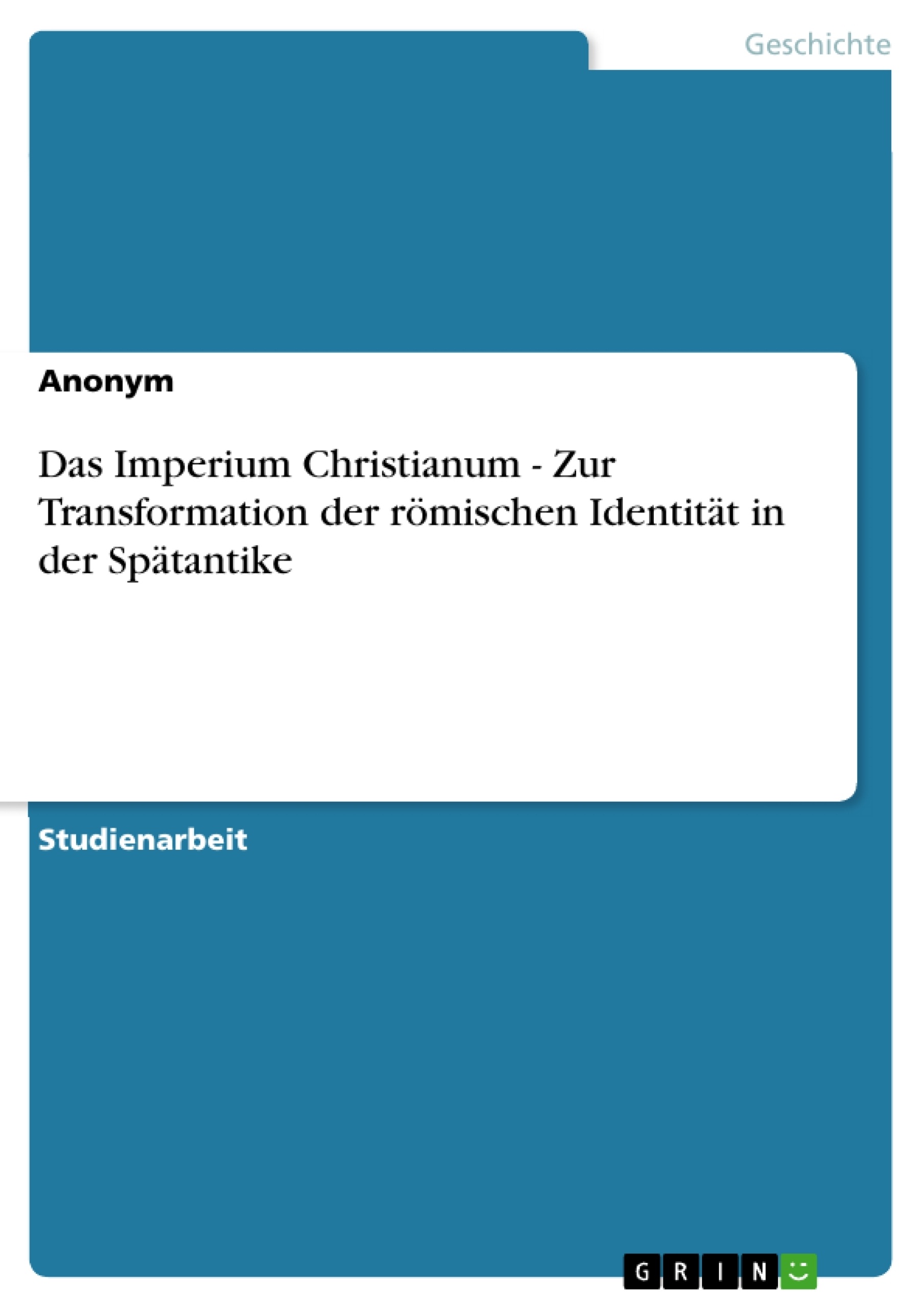[...] Diese Arbeit setzt sich daher zum Ziel, den Begriff der „Identität“ für das spätantike Reich
anzuwenden. Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage, ob es so etwas wie eine „römische
Identität“ gegeben hat und was darunter in dem hier zu betrachtenden Zeitraum verstanden
wurde. Wenn dieser Beweis erbracht wird, stellt sich die Frage, auf welchen Ebenen
Identitätskonstituierung überhaupt möglich war und vollzogen wurde. Inwiefern schuf die
Konstruktion einer Identität für das Imperium existentielle Grundlagen, und welche
Bedeutung darf dieser Identität in einer Epoche des Wandels mit signifikanten Zäsuren
zukommen? Zu beweisen ist, ob die Konstruktion einer Identität im Zuge des
Transformationsprozesses Konsequenzen für das Fortbestehen und Überleben des Imperium
Romanum in Zeiten des Umbruchs und der „Krise“ hatte. Auf diesen Fragen aufbauend verfolgt die Arbeit folgende Struktur:
Zunächst soll der Identitätsbegriff für den Gebrauch in diesem spezifischen Kontext definiert
werden. Mithilfe dieser methodischen Grundlage soll im zweiten Kapitel der Identitätsbegriff
auf das Römische Reich angewendet werden. Es soll gezeigt werden, dass das Imperium
Romanum sich aufgrund verschiedener Transformationsprozesse zu einem Imperium
Christianum wandelte. Die Identität des neuen Imperiums konnte einerseits durch die
Selbstbestimmung und andererseits durch die Abgrenzung zum Fremden gefestigt werden.
Auf drei Dimensionen der Selbstbestimmung (III.1a. Erziehung und Bildung; b. Kaiserideologie;
c. Staatlichkeit) soll gezeigt werden, wie die christliche Lehre in die römische
Gesellschaft eindringen konnte und an der Konstruktion einer neuen Identität mitwirkte. Die
Abgrenzung zum Fremden erfolgte durch die Gegenübersetzung des „Hellenen“ und des
„Barbaren“.
Diese identitätsstiftende Ordnung sah sich in der Spätantike mehrmals existentiell bedroht.
Ein Identitätsverlust hätte zum Auseinanderfallen der imperialen Ordnung geführt. Besonders
in solchen „Krisenzeiten“ bemühte man sich radikal und konsequent um eine
Identitätssicherung (IV. 1-3). Die Transformation der ursprünglich klassisch-römischen
Identität zur christlich-römischen wurde zu Zeiten der Bedrohung beschleunigt.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Zur Konstruktion von Identität - ein Definitionsansatz
III. Zur Transformation einer Identität - die Entstehung des Imperium Christianum
1. Identität - „der Römer“
a. Bildung und Erziehung
b. Kaiserideologie
c. Staatlichkeit im Imperium Christianum
2. Alterität - „der Andere“
a. Der „Hellene“
b. Der „Barbar“
IV. Drei historische Phasen der Identitätsbedrohung
1. Phase 1
2. Phase 2
3. Phase 3
V. Fazit
VI. Literaturverzeichnis
1. Ausgaben der Primärtexte
2. Sekundärliteratur