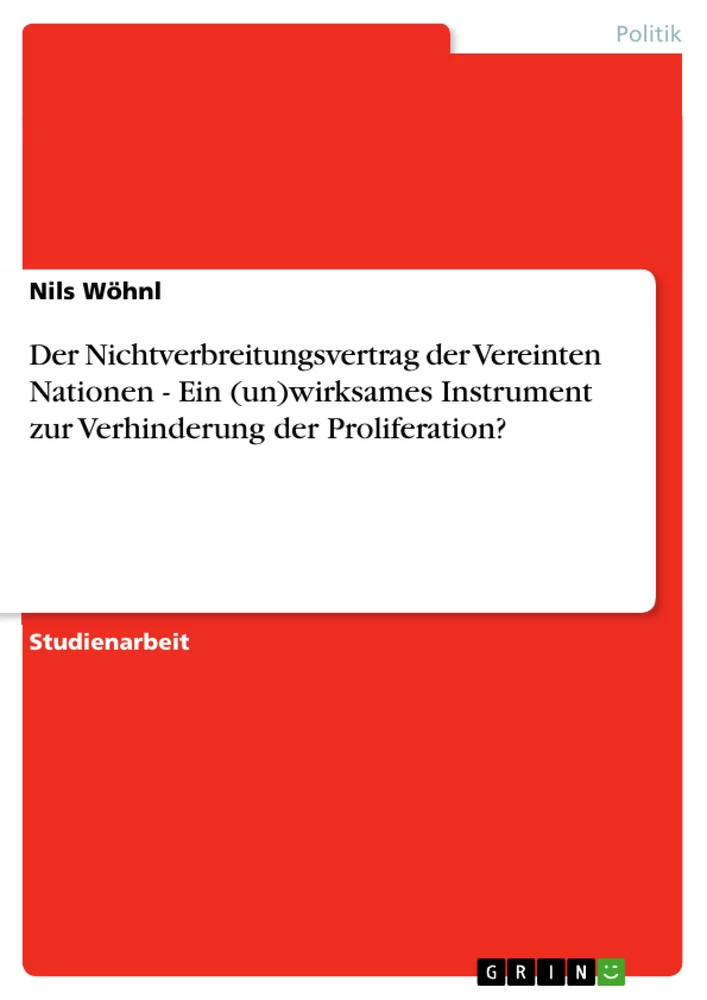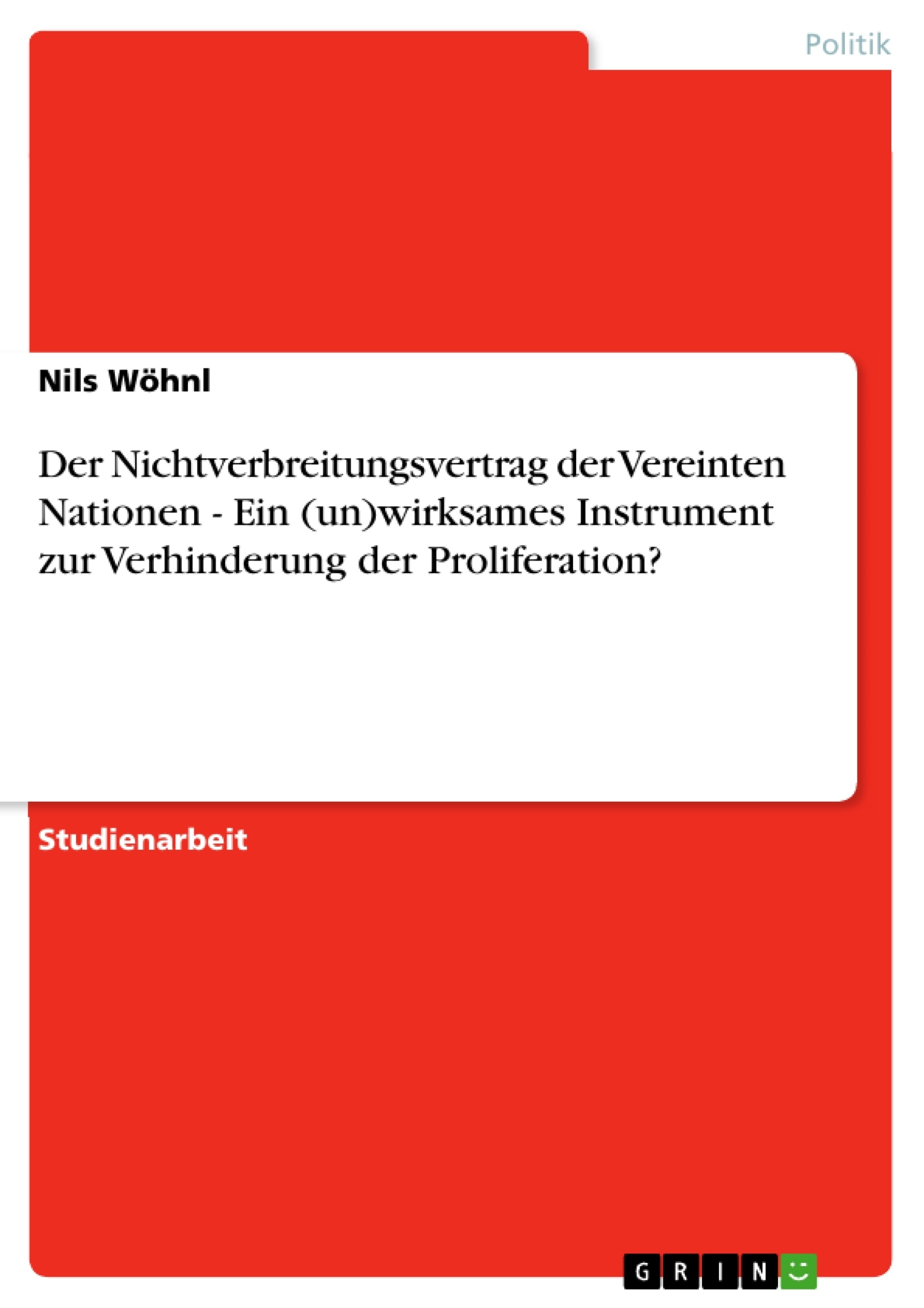In meiner Arbeit soll es darum gehen, aufzuzeigen, inwiefern der Nichtverbreitungsvertrag
der Vereinten Nationen wirkungsvoll ist. Als Beispiel soll hierfür der Konflikt
um das Iraner Atomprogramm gelten. Um diesen Konflikt näher untersuchen zu
können und ihn mit dem Nichtverbreitungsvertrag in Verbindung bringen zu können,
werde ich die Außenpolitik zweier wichtiger ständiger Sicherheitsratsmitglieder,
USA und Russland, in Bezug auf das iranische Atomprogramm darstellen und versuchen
Schlüsse für die Gründe der jeweiligen Außenpolitik zu ziehen. Die USA und
Russland habe ich deswegen als Beispiel für die Außenpolitik gegenüber dem Iran
herangezogen, da sowohl die USA als auch Russland zu den Unterzeichnern des
Nichtverbreitungsvertrags der Vereinten Nationen gehörten und somit erhebliches
Interesse an der Nichtverbreitung von Atomwaffen haben, wie sie der Iran droht bauen
zu können. Des Weiteren werde ich noch die Außenpolitik Deutschlands in Bezug
auf das Iraner Atomprogramm betrachten, obwohl Deutschland kein ständiges Mitglied
im UN-Sicherheitsrat ist, so ist es als mit der Unterzeichnung und Ratifizierung
des Nichtverbreitungsvertrages dafür verantwortlich, die Einhaltung des Vertrages
durch die einzelnen Vertragspartner mit zu kontrollieren.
Der Nichtverbreitungsvertrag trat im Juli 1970 offiziell in Kraft, wurde aber schon
1968 von den USA, Russland (damals noch Sowjetunion) und Groß-Britannien unterzeichnet.
Deutschland unterzeichnete den Nichtverbreitungsvertrag 1969, der Iran
hat den Nichtverbreitungsvertrag sogar schon ein Jahr früher unterzeichnet und ebenfalls
1970 ratifiziert. Der Nichtverbreitungsvertrag beinhaltet die Ächtung von ABCWaffen,
deren Nichtverbreitung, sowie das Verbot mit Waren zu handeln, die zum
Bau von Nuklearwaffen genutzt werden können. Um zu gewährleisten, dass die einzelnen
unkte des Vertrages von den einzelnen Unterzeichnerstaaten eingehalten werden
hat der UN-Sicherheitsrat folgende Kontrollinstanz ins Leben gerufen: Die Internationale Atomenergiebehörde, die unangekündigt Inspektionen in Ländern durchführen
kann, von denen angenommen wird, dass sie vorhaben, Nuklearwaffen zu
bauen und auch die Technologie dafür haben.
Nun hat der Iran schon in den 60er Jahren damit begonnen, ein Atomprogramm
im eigenen Land auf die Beine zu stellen. Die Atomenergie sollte allein der Stromversorgung
im Land dienen. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Der Nichtverbreitungsvertrag der Vereinten Nationen und der Beginn des Konflikts mit dem Iran
2. Die Außenpolitik der UN-Sicherheitsratsmitglieder USA und Russland und die Außenpolitik Deutschlands in Bezug auf das Iraner Atomprogramm
2.1 Die US-amerikanische Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm
2.1.1 Die US-amerikanische Außenpolitik in Bezug auf das iranische Atomprogramm unter Clinton 1996-2000
2.1.2 Die US-amerikanische Außenpolitik in Bezug auf das iranische Atomprogramm unter Bush 2001-2008
2.1.3 Die US-amerikanische Außenpolitik in Bezug auf das iranische Atomprogramm unter Obama 2009
2.1.4 Zusammenfassung des Kapitels
2.2 Die russische Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm
2.2.1 Die russische Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm unter Jelzin 1991-1999
2.2.2 Die russische Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm unter Putin 2000-2008
2.2.3 Zusammenfassung des Kapitels
2.3 Die deutsche Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm
2.3.1 Die deutsche Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm unter Kohl 1990-1998
2.3.2 Die deutsche Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm unter Schröder 1999-2005
2.3.3 Die deutsche Außenpolitik in Bezug auf das Iraner Atomprogramm unter Merkel ab 2005
2.3.4 Zusammenfassung des Kapitels
3. Fazit: Wie könnte der Konflikt mit dem Iran weitergehen?
4. Literaturverzeichnis
5. Eidesstattliche Erklärung