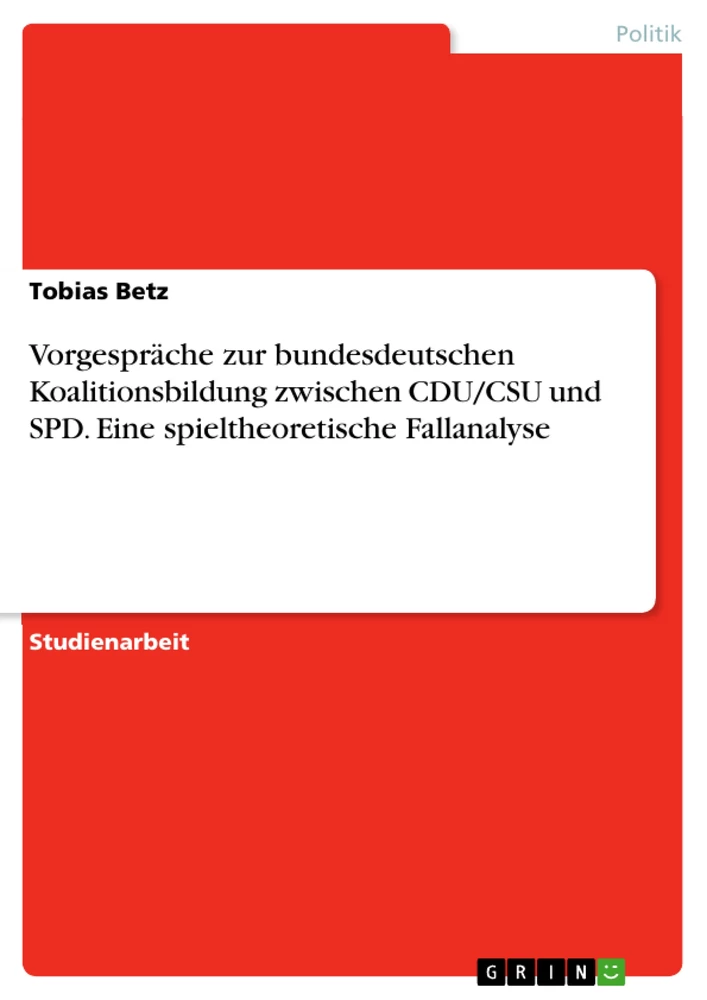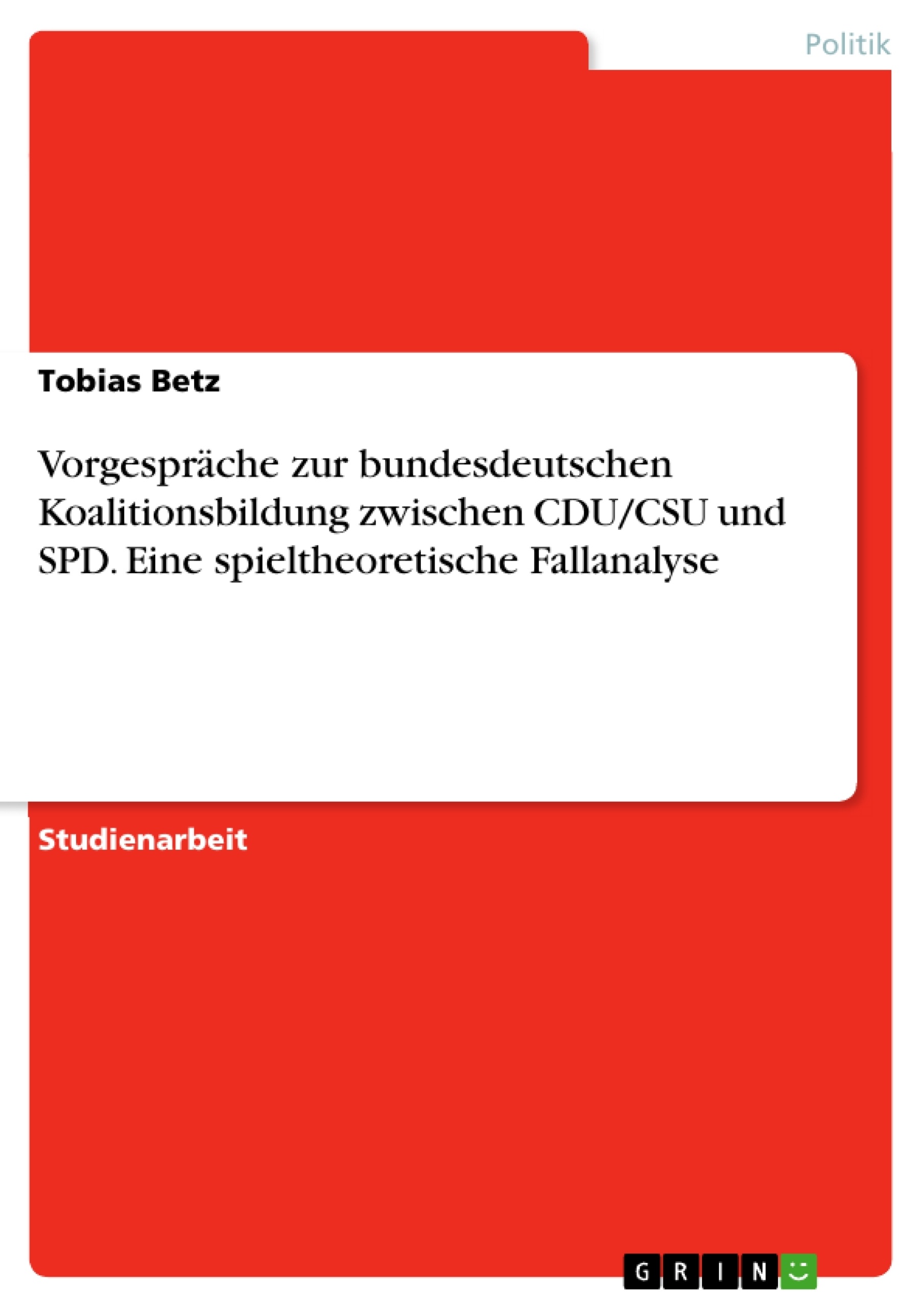“The government formation process ends with the creation of a new govern-ment – a new set of managers of the various departments of the state. But what of its beginning?” (Shepsle und Boncheck 1997, 437).
Was kommt zuerst, Minister oder Ministerium? Im Zuge einer Koalitionsbildung, die vornehmlich in parlamentarischen Systemen vonstattengeht, schmieden Parteien ein Bündnis, um die notwendige Mehrheit zur Regierungsbildung zu erreichen (Riker 1975, Schofield und Sened 2006, von Neumann und Morgenstern 1953). Allerdings kommt dieser Pakt selten einer „Liebesheirat“ gleich, sondern harte Verhandlungen über Ämter und Inhalte deuten eher auf einen „Rosenkrieg“ hin.
In vorliegender Arbeit werden die Vorgespräche zu den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD nach den Bundestagswahlen 2005 koalitionstheoretisch verortet und spieltheoretisch entschlüsselt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Koalitionstheorien: Spannungsverhältnis zwischen Amt und Inhalt
1.1 Ämterorientierte Koalitionstheorien
1.2 Politikorientierte Koalitionstheorien
2. Koalitionstheoretische Synthese: Policy, Office, Votes
3. Fallanalyse: Vorgespräche der Koalitionsbildung 2005
3.1 Nutzenfunktion und Auszahlungen
3.2 Modellierung des Spielbaums
4. Interpretation des Ergebnisses und Fazit
Literaturverzeichnis