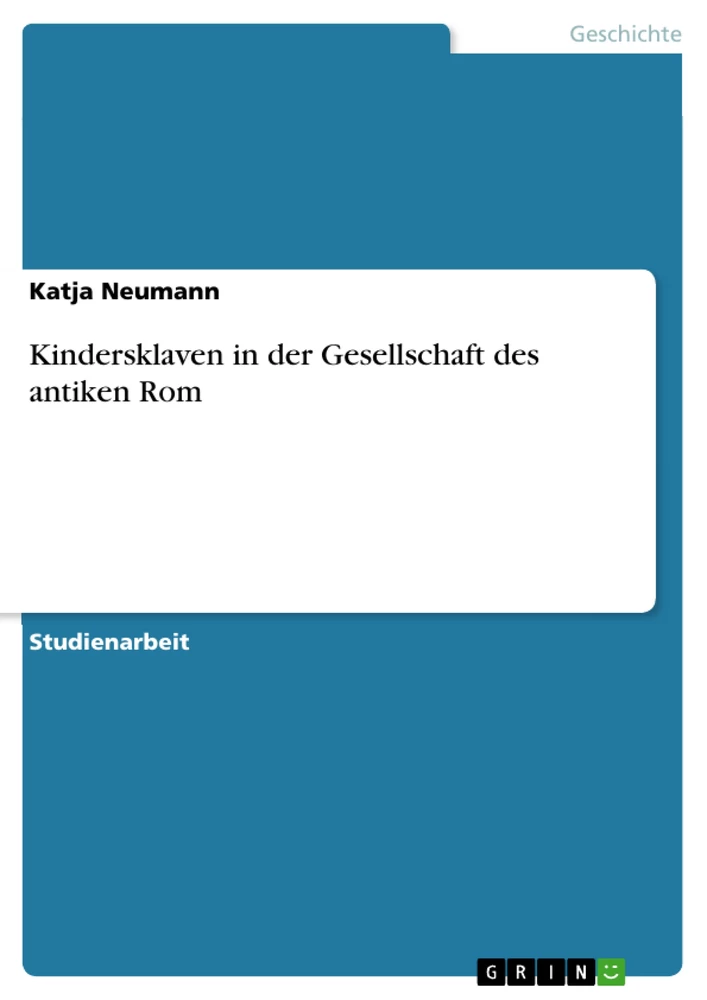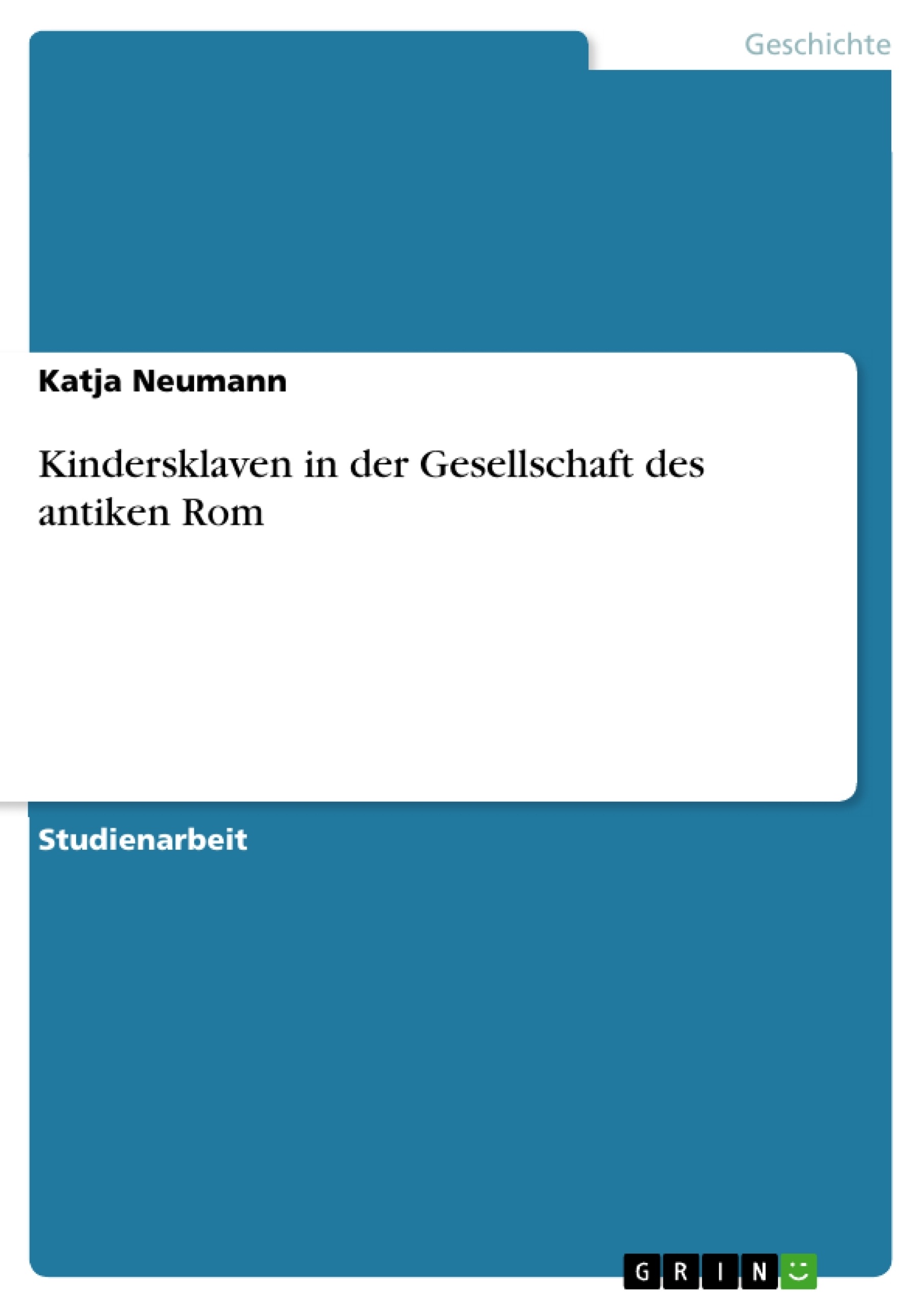In der römischen Antike war das Halten von Sklaven üblich und stellte – wie in so ziemlich allen Zeiten der Sklaverei – einen wichtigen Wirtschaftsfaktor, aber auch ein Prestigeobjekt dar. Die Bürger des antiken Roms hätten sich ein Leben ohne Sklaven nicht vorstellen können, sie gehörten zum Alltag und übernahmen einen Großteil der anfallenden Arbeiten für die Mehrheit der römischen Bevölkerung, in einem umfassenden Tätigkeitsfeld. Daher war die Versklavung von Menschen sehr bedeutsam für die römische Gesellschaft. In Sklaverei geriet unteranderem, wer seine Schulden nicht bezahlen konnte, als Kriegsgefangener oder Opfer einer Entführung durch Piraten auf einem Sklavenmarkt verkauft wurde oder Kinder, die den Status ihrer Eltern automatisch geerbt hatten bzw. auf anderem Wege ihre Freiheit verloren. Sklavenkinder waren also genauso an ihren Herren gebunden, wie gewöhnliche Sklaven auch.
Die Intention der folgenden Arbeit liegt in der Beschreibung der Bedeutung von Kindersklaven für die Gesellschaft des antiken Roms. Dabei erscheinen die Fragen interessant, wer diese Kinder waren, wer sie aufzog und für sie sorgte und zu welchen Tätigkeiten sie herangezogen wurden? Es wird der Versuch unternommen die verschiedenen Möglichkeiten unter denen ein Sklavenkind großgezogen werden konnte darzustellen und anhand von geeigneten Quellen zu belegen.
Abschließen soll eine Bilanz über das Leben der Kinder in der Sklaverei der antiken römischen Gesellschaft gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wie ein Kind „unfrei“ wurde
3. Großwerden als Sklavenkind
3.1 Die Ausbildung eines Sklavenkindes
3.2 Der Wert eines Sklavenkindes
4. Tätigkeitsfelder von Sklavenkindern
5. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Quellenangabe
Abbildungsverzeichnis