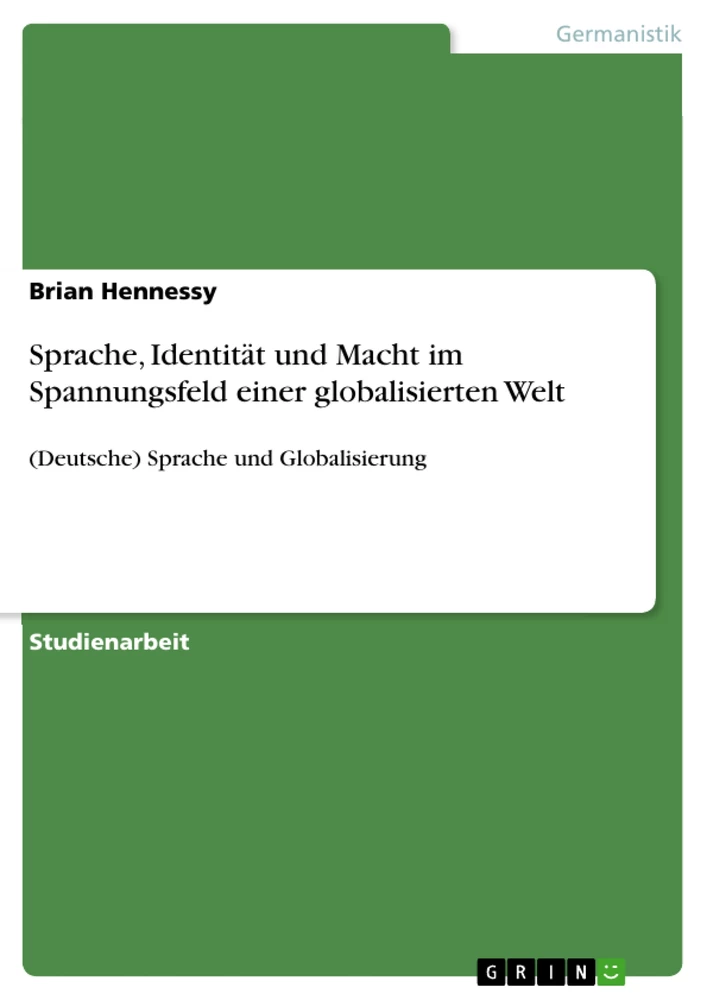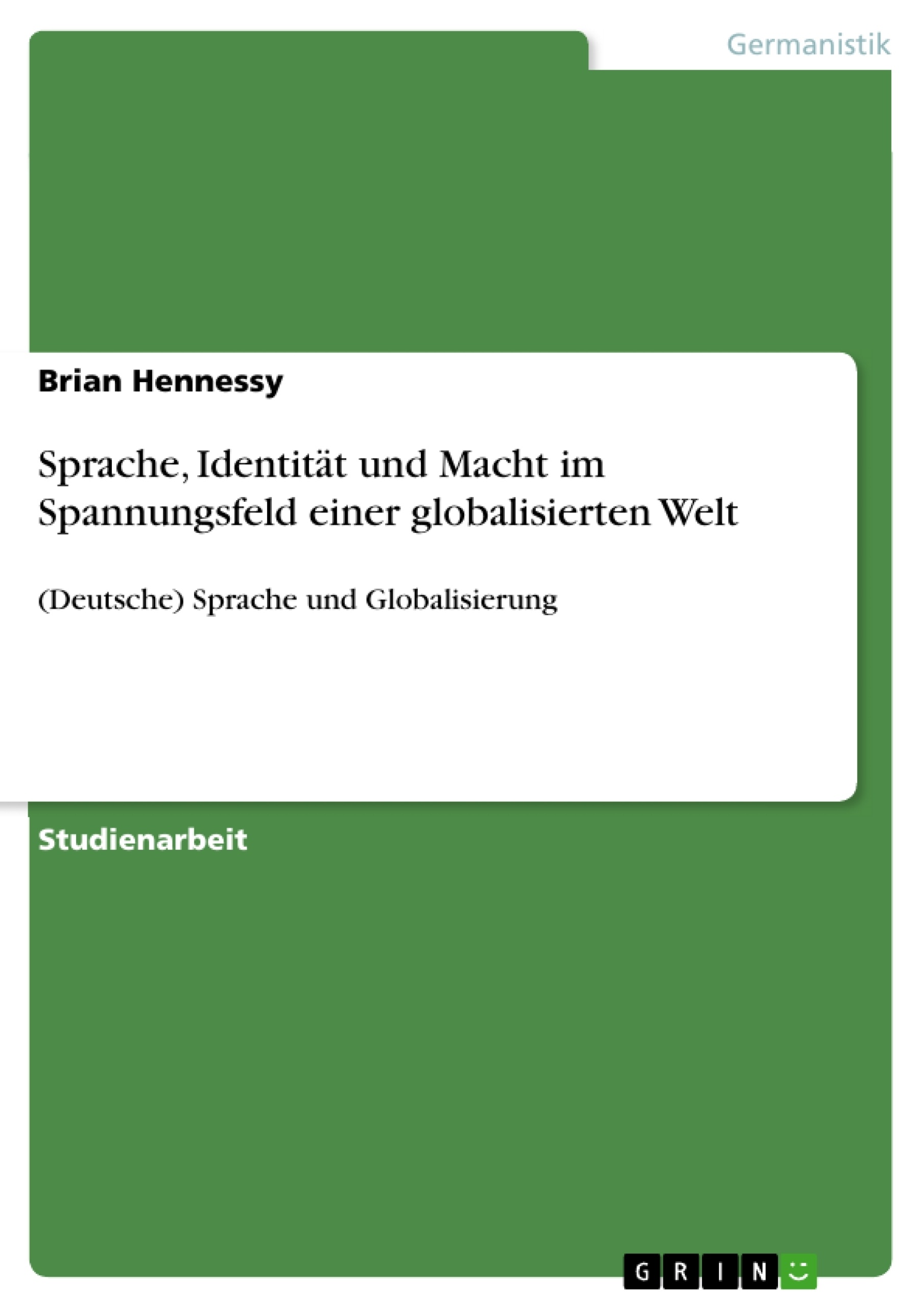In diesem mit Abbildungen, Rubriken und Referenzen ergänzten Aufsatz wird die Frage beleuchtet, wie die deutsche Sprache die Macht- und Identitätsverhältnisse der modernen Gesellschaft der 19 und 20 Jahrhunderts beeinflusst und geformt hat und welchen Einfluss sie auf Politik, Region und Wissenschaft ausgeübt hat. Des Weiteren werden folgende Fragestellungen in Betracht gezogen: Welche Rolle spielt Sprache vor dem Hintergrund einer globalisierten Welt und inwiefern liefert Sprache Bezugspunkte für eine eigene nationale Identität? Zu guter Letzt wird erörtert, welche grosse Stütze Sprachbegriffe (z.B. Schlagwort, Symbolik und Euphemismus) beim Aufdecken der Macht- und Identitätsverhältnisse bezogen auf Sprache darstellen können. Im Laufe des Aufsatzes wird der Leserschaft allmählich klar, wie Sprache unsere Welt beeinflussen kann, je nachdem in welcher Richtung der Wind des Zeitgeistes weht.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.0 Sprache: Bezug zur Macht und Identität
2.0 Sprache und Region: Identität und Plurizentrizität
2.1 Fallbeispiel: Schweiz und Liechtenstein
2.2 Schwaben: Verteidigung der regionalen Identität
3.0 Ausländerintegration: Wenn die Macht einer Sprache zur interkulturellen Schranke wird
4.0 Sprache: Die Erfindung des Buchdrucks und deren Einfluss auf Macht- und Identitätsverhältnisse innerhab Europas
5.0 Welche Rolle spielt Sprache in einer globalisierten Welt?
6.0 Sprache und Wissenschaft: Zweiter Weltkrieg
7.0 Macht und Identität: Bezüge zur Sprache in der Politik
7.1 Fachsprache
7.2 Identifikations- und Kommunikativsprache
7.3 Symbolik und Symbolwörter
7.4 Schlagwörter
7.5 Schlag- und Symbolwörter im Vergleich
7.6 Symbol- und Schlagwörter: Sprache der DDR
7.7 Sprache: Mauer, Wende und die deutsche Identität
7.8 Die Macht der Sprache in Bezug auf das Schicksal einer Nation: Berlin,
7.9 Schlagwörter zwischen Ost und West
7.9.1 Ostalgie
7.9.2 Wessie
7.9.3 Ossie
7.10 Schlagwort der Wirtschaft: Der Teuro
7.11 Politische Wahlplakate und Slogans: Einflussfaktoren auf die Identitäts- und Machtverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft
7.11.1 Bundestagswahlkampf
7.11.2 Bundestagswahlkampf
Fazit
Endnoten
Bibliographie
EMA
Sprache, Identität und Macht im Spannungsfeld einer globalisierten Welt