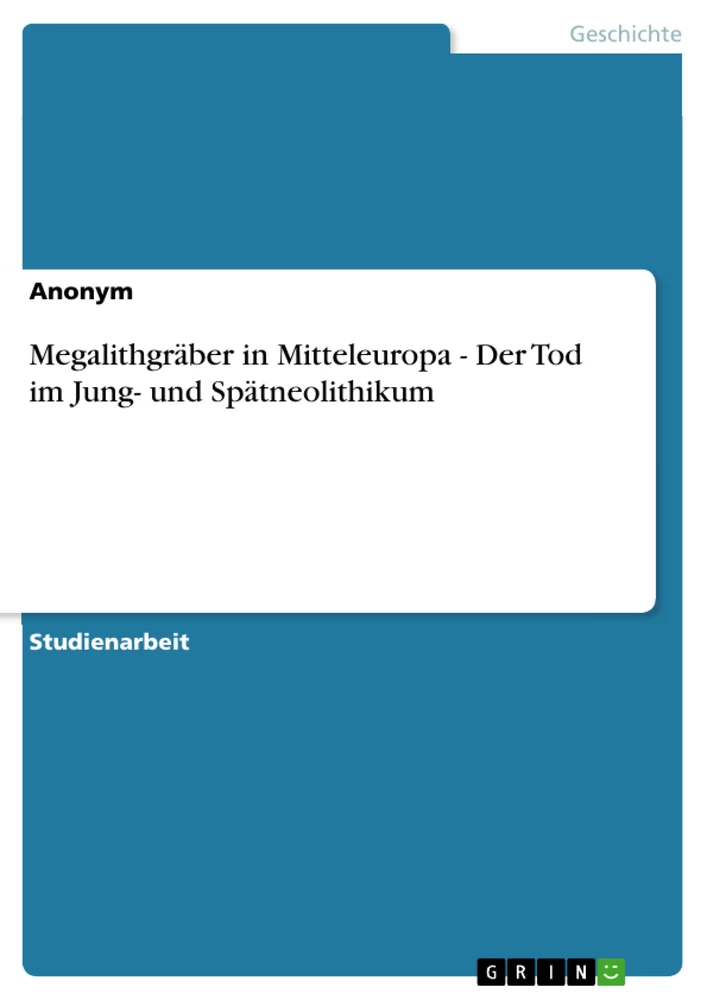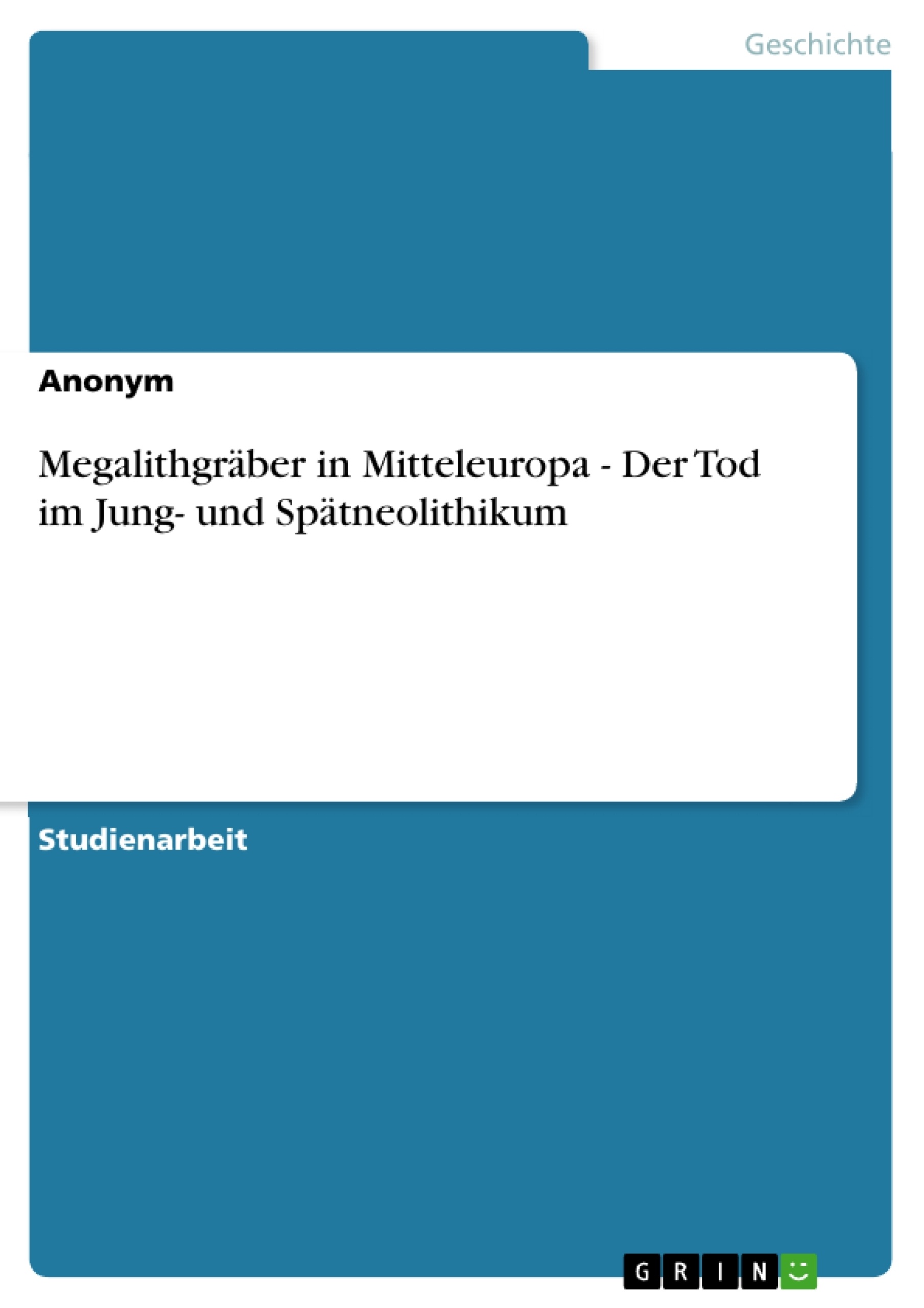"Wo unsere ältesten Urkunden, sei es, daß man sie auf Pergament geschrieben oder in Stein
gemeißelt hat, zu berichten aufhören, da fragt die Vorgeschichtsforschung mit dem Spaten bei der
Mutter Erde an - und sie antwortet, wenn man ihr Blatt für Blatt in geduldiger Spatenarbeit die
Antwort abzwingt."(1)
Dieser für die Archäologie stellvertretende Satz krönt auch die Forschungen, zu denen die
vorliegende Arbeit Stellung bezieht, denn weltweit stoßen wir auf die Überreste von
Megalithgrabkulturen, die sich nicht unter einem Banner führen lassen.
So finden wir 1000 Jahre vor der zu betrachtenden Zeit in Nordostfrankreich eine ebenfalls unter
großen Steinen beerdigende Kultur. Viele Dekaden später auch in Italien und sogar in Südamerika.
Unabhängig voneinander führt die Begrabenden nur ein Faktum zusammen. Sie wollten das Prinzip
der kollektiven Bestattung von Menschen, welches Schicksal diese auch immer zusammengeführt
hat, möglichst monumental, unter Zuhilfenahme von großen Steinblöcken, oberirdisch für eine
lange Zeit festhalten und das Andenken an die Verstorbenen bewahren.
Allerdings scheint für die Gesellschaft der Lebenden der einzelne Tote nicht im Vordergrund zu
stehen. Sein Einzug in eine Art Totenreich, mindestens jedoch in eine Ahnenreihe als namenloser
Vorfahre der Sippe, war wesentlich wichtiger. Deswegen sind die Megalithgräber auch
Kollektivgräber.
Weiterhin ist ein interessanter Fakt bei den Knochenfunden zu beobachten.
Generell kann man von einer relativ schlechten Befundlage ausgehen, sehr viele Gebeine sind nur
in Bruchstücken erhalten. Es wirkt jedoch fast auffällig, dass, sobald die Überreste entweder in eine
sehr kalkige Sandschüttung eingebettet waren oder auch nur auf Kalksteinen lagen, meist sehr
wenig vom Verfall berührt wurden.
Diesen Aussagen und Beobachtungen soll die folgende Ausarbeitung Hand und Fuß verleihen. [...]
Inhaltsverzeichnis
1.)Einleitung
1.1.)Mitteleuropäische Großsteingräber im gesamteuropäischen Kontext
1.2.)Forschungs- und Zerstörungsgeschichte - ein Auszug
1.3.)Räumliche und zeitliche Einordnung der Gräber
2.)Die Normalformen
2.1.)Der Urdolmen
2.1.a)Der Urdolmen mit Einstieg von oben durch Deckplatten (/eine Deckplatte)
2.1.b)Der Urdolmen mit seitlichem Einstieg über eine Deckplatte
2.1.c)Der Urdolmen mit seitlichem Einstieg durch einen Gang
2.2.)Der erweiterte Dolmen
2.2.a)Der erweiterte Dolmen mit seitlichem Einsteig durch eine Türplatte
2.2.b)Der erweiterte Dolmen mit seitlichem Einstieg durch eine Lücke
2.2.c)Der erweiterte Dolmen mit einem kurzen Einstiegsgang
2.3.)Der Großdolmen
2.3.a)Der Großdolmen mit Einstieg durch eine Lücke oder mithilfe einer Deckplatte
2.3.b)Der Großdolmen mit Einstieg durch einen Gang an der Vorderseite
2.3.c)Der Großdolmen mit Einstieg durch einen Vorraum oder seitlichen Gang
2.4.)Das Ganggrab
2.5.)Das Hünenbett
2.6.)Die Steinkiste
3.)Die Architektur der Großsteingräber
4.)Spezieller Umgang mit den Toten
4.1.)Brandspuren
4.2.)Überlegungen zu Totenkult und Religion
5.)Zusammenfassung und Schlussbemerkungen
6.)Literaturangabe