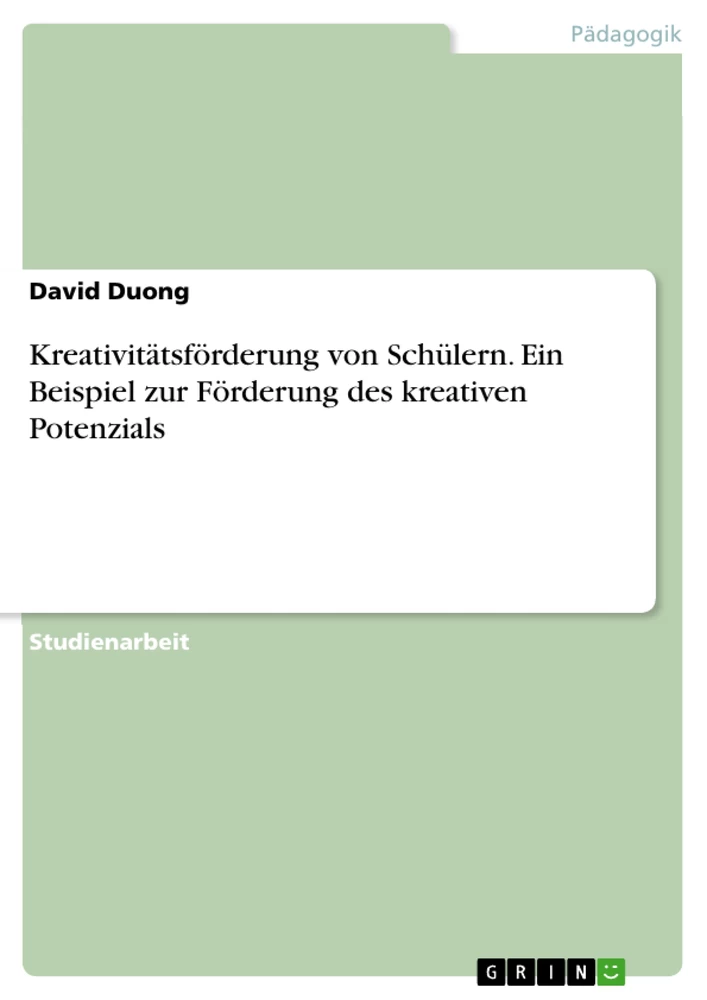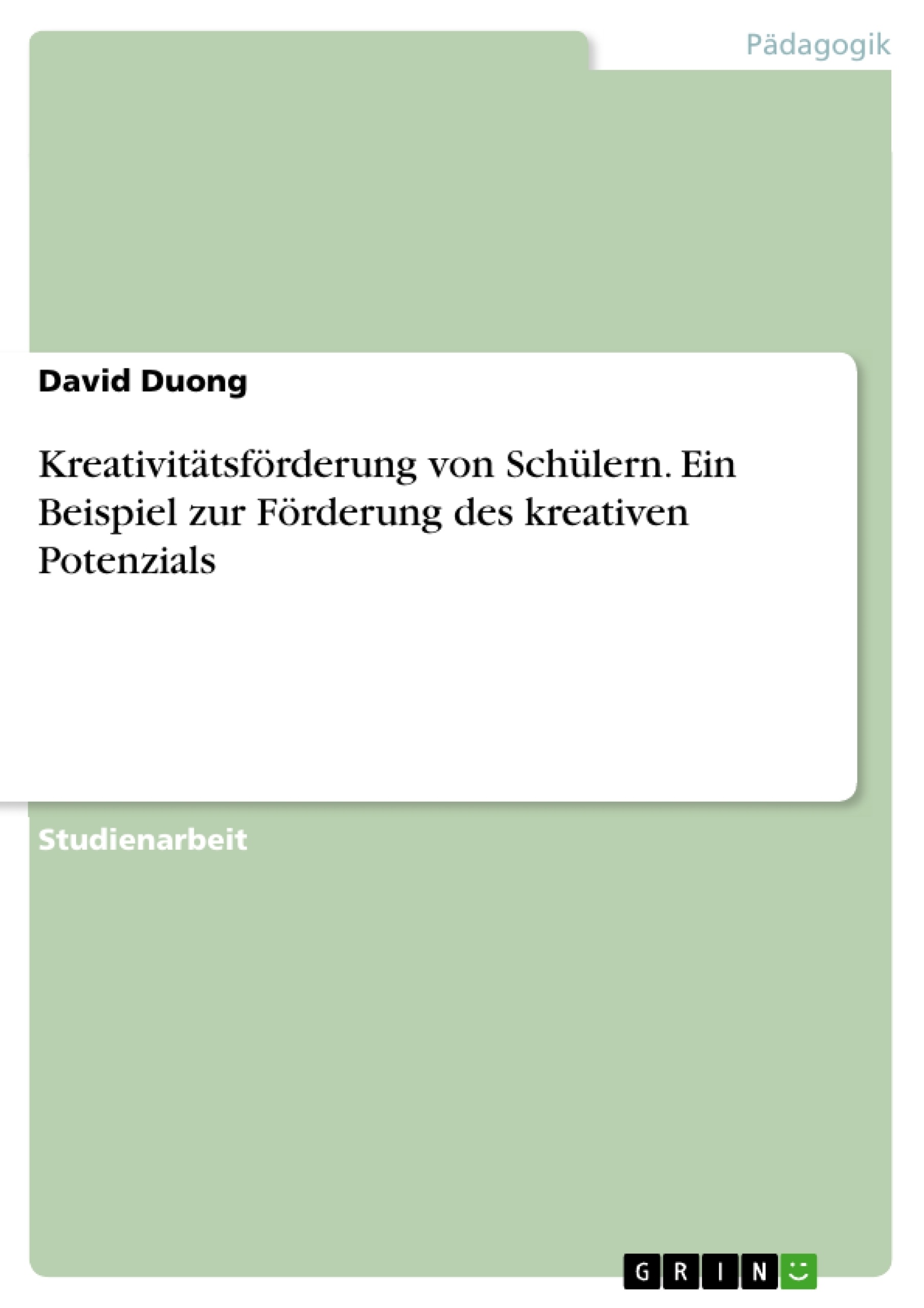In der Ausarbeitung werde ich zunächst den Begriff und die Funktionen der Kreativität näher erläutern. Danach kommt es zur Untersuchung von unterschiedlichen Rahmenbedingungen für kreatives Verhalten, wobei ich zusätzlich auf ihre Kriterien eingehen werde. Überdies werden diese Bedingungen im Lichte des Schulunterrichts betrachtet. Die nächsten Betrachtungsschwerpunkte beschäftigen sich dann mit den psychischen Aspekten der Kreativität, wo besonders die Merkmale einer kreativen Person und die psychischen Phasen des kreativen Prozesses erklärt werden. Außerdem wird die Rolle der Kunst für die Kreativitätsförderung näher analysiert.
Im Anschluss wird von mir ein Unterrichtsbeispiel aus dem Kunstbereich vorgestellt, das meiner Meinung nach sehr gut zur Kreativitätsentfaltung geeignet ist. Dieser Unterricht beinhaltet das Thema Selbstbild und ist für Schüler der elften Klasse konzipiert.
Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
II. Kreativität
2.1. Der Kreativitätsbegriff
2.2. Die allgemeinen Rahmenbedingungen für Kreativität
2.3. Psychische Analyse des kreativen Prozesses
2.4. Kreativität im Kunstunterricht
III. Konzept zur Förderung der Kreativität bei Jugendlichen:
3.1. Inhalte und Ziele der Unterrichtsreihe im Kunstunterricht
3.2. Theoretische Vorbereitung und Fotoaufnahme
3.3. Arbeit an Stationen
3.4. Ergebnisse des Unterrichts
3.5. Meine Beurteilung der Unterrichtsreihe
IV. Fazit