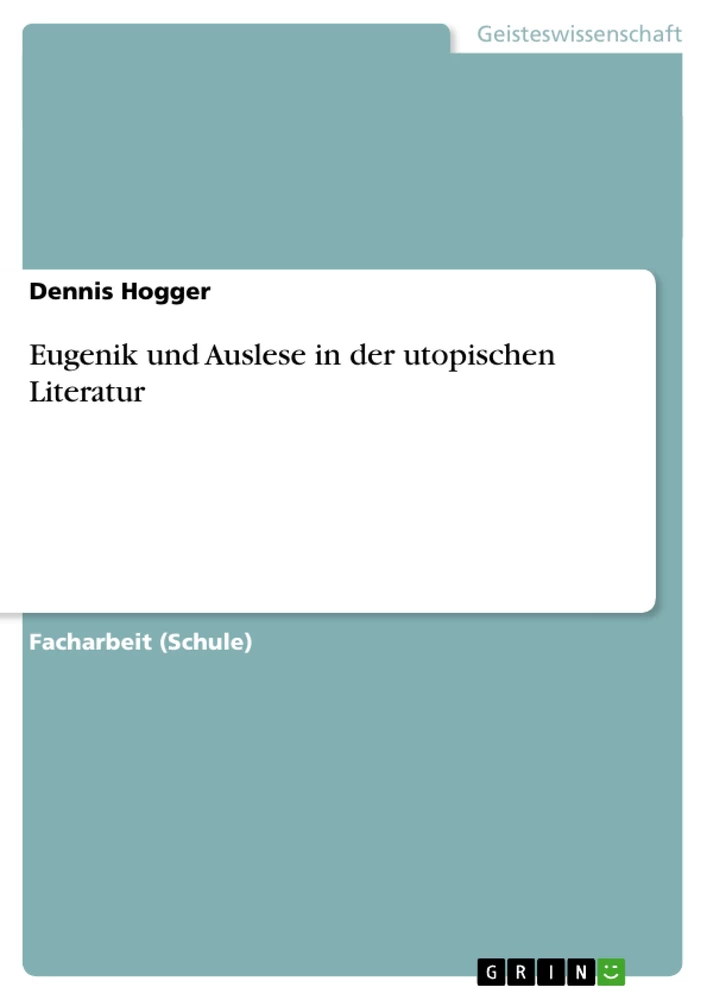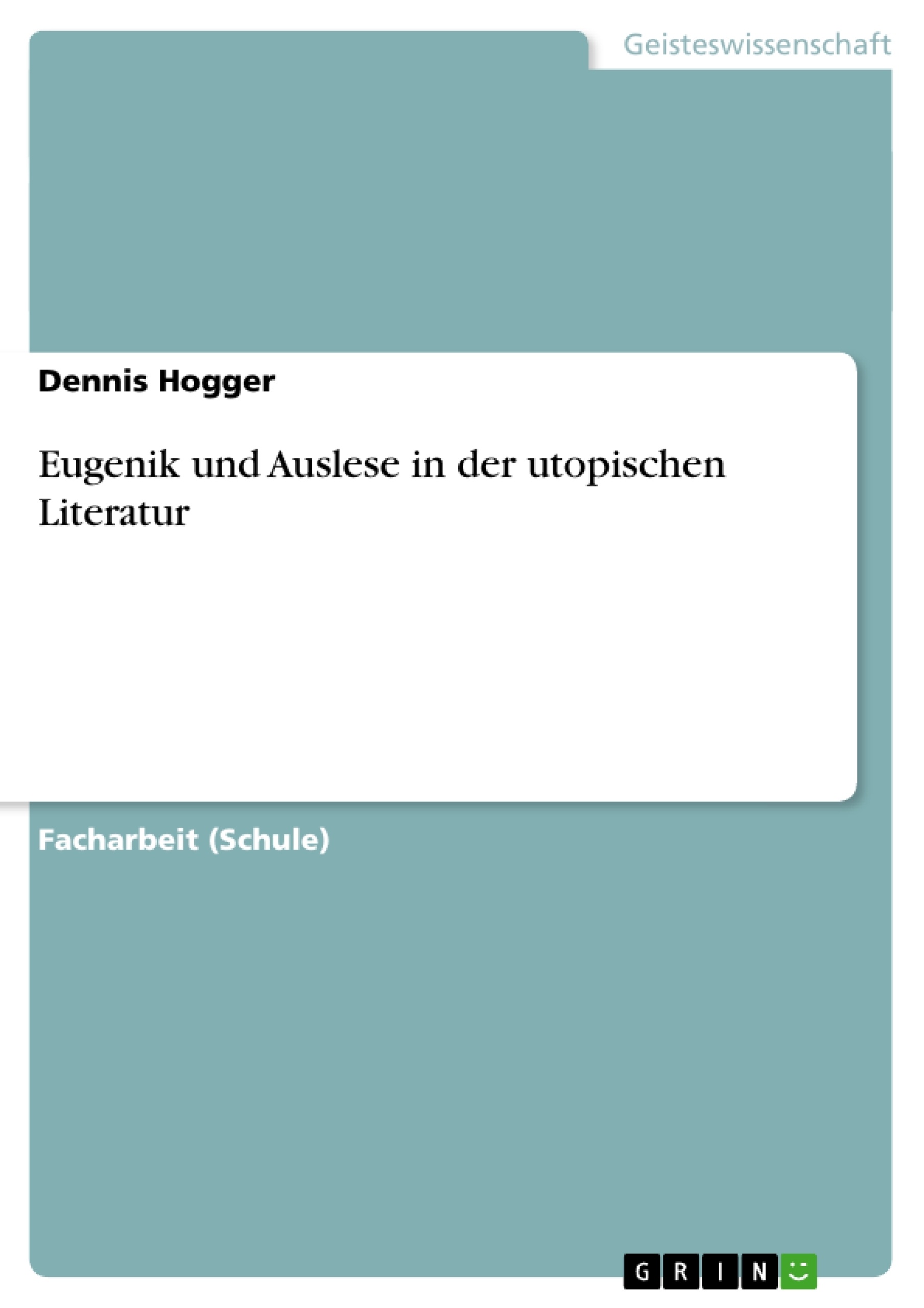Ich versuche in dieser Arbeit einen Themenkomplex zu behandeln, der in der modernen Utopieforschung bisher leider größtenteils außen vor gelassen wurde. Ich spreche von zwei der unmoralischsten Praktiken, die ein Staat verfolgen kann: Eugenik und Auslese. Dass diese Themen nicht erst seit den Rassentheorien der Nationalsozialisten aktuell sind, versuche ich ebenso zu zeigen wie die Tatsache, dass sich auch große Philosophen ernsthaft mit solchen staatlichen Maßnahmen auseinandergesetzt haben, und zwar nicht bloß vom Standpunkt eines Kritikers aus. Zu beachten ist, dass ich das Wort „utopisch“ im Titel explizit als Gegenteil zu „dystopisch“ verstehe. Es ist mir unverständlich, wieso in der Literaturwissenschaft die Dystopien des 20. Jahrhunderts als Utopien bezeichnet werden, obwohl sie mit den klassischen Utopien des Altertums nichts zu tun haben. Während jene meiner Ansicht nach bloß nach ästhetischen Gesichtspunkten beurteilt werden können, sind diese oftmals strengstens zu kritisieren. Man muss sich klarwerden, dass Praktiken wie die Eugenik und die Auslese, verwendet in klassischen Utopien, nicht nur als gut, sondern als perfekt angesehen werden. Vor allem die Argumente, die dafür angeführt wurden, werde ich in meiner Arbeit beleuchten.
Exemplarisch werde ich die Problemstellung an den zwei berühmtesten Utopien der Literaturgeschichte untersuchen: an der „Politeia“ von Platon und an der „Utopia“ von Thomas Morus. Die Bekanntheit dieser beiden Werke bringt es mit sich, dass unfassbar viele Kommentare dazu verfasst wurden, die oftmals in ihrem Inhalt extrem voneinander abweichen. Ein besonderer Aspekt meiner Arbeit wird sein, die unterschiedlichen Interpretationen aufzuzeigen, sodass sich der Leser selber ein Urteil über das Thema bilden kann. Ich werde die beiden Werke nicht komplett voneinander getrennt behandeln, sondern im zweiten Teil über Morus immer wieder auf den bereits behandelten Platon verweisen. In beiden Teilen gehe ich zuerst auf die Eugenik und dann, ausführlicher, auf die verschiedenen Aspekte der Auslese ein.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Platon – Politeia
1. Allgemeine Einführung
2. Die Rolle der Eugenik in Platons Staat
3. Stände, Auslese und Königswahl in der „Politeia“
3.1 Natürliche Veranlagungen und der Mythos der Erdgeburt
3.2 Das Kastensystem in der Politeia
3.3 Der Weg zum Philosophenherrscher
III. Thomas Morus – Utopia
1. Allgemeine Einführung
2. Die Rolle der Eugenik in Morus´ „Utopia“
3. Auslese in der „Utopia“
3.1 Wissenschaftliche Veranlagungen
3.2 Die Sklavenhaltung in Utopia
3.3 Das Ständewesen und die staatlichen Ämter in Utopia
3.4 Ist die Utopia ein Klassenstaat?
3.5 Auslese bei der Partnerwahl
IV. Schlussbetrachtung
Verzeichnis der verwendeten Literatur
I. Einleitung
Ich versuche in dieser Arbeit einen Themenkomplex zu behandeln, der in der modernen Utopieforschung bisher leider größtenteils außen vor gelassen wurde. Ich spreche von zwei der unmoralischsten Praktiken, die ein Staat verfolgen kann: Eugenik und Auslese. Dass diese Themen nicht erst seit den Rassentheorien der Nationalsozialisten aktuell sind, versuche ich ebenso zu zeigen wie die Tatsache, dass sich auch große Philosophen ernsthaft mit solchen staatlichen Maßnahmen auseinandergesetzt haben, und zwar nicht bloß vom Standpunkt eines Kritikers aus. Zu beachten ist, dass ich das Wort „utopisch“ im Titel explizit als Gegenteil zu „dystopisch“ verstehe. Es ist mir unverständlich, wieso in der Literaturwissenschaft die Dystopien des 20. Jahrhunderts als Utopien bezeichnet werden, obwohl sie mit den klassischen Utopien des Altertums nichts zu tun haben. Während jene meiner Ansicht nach bloß nach ästhetischen Gesichtspunkten beurteilt werden können, sind diese oftmals strengstens zu kritisieren. Man muss sich klarwerden, dass Praktiken wie die Eugenik und die Auslese, verwendet in klassischen Utopien, nicht nur als gut, sondern als perfekt angesehen werden. Vor allem die Argumente, die dafür angeführt wurden, werde ich in meiner Arbeit beleuchten.
Exemplarisch werde ich die Problemstellung an den zwei berühmtesten Utopien der Literaturgeschichte untersuchen: an der „Politeia“ von Platon und an der „Utopia“ von Thomas Morus. Die Bekanntheit dieser beiden Werke bringt es mit sich, dass unfassbar viele Kommentare dazu verfasst wurden, die oftmals in ihrem Inhalt extrem voneinander abweichen. Ein besonderer Aspekt meiner Arbeit wird sein, die unterschiedlichen Interpretationen aufzuzeigen, sodass sich der Leser selber ein Urteil über das Thema bilden kann. Ich werde die beiden Werke nicht komplett voneinander getrennt behandeln, sondern im zweiten Teil über Morus immer wieder auf den bereits behandelten Platon verweisen. In beiden Teilen gehe ich zuerst auf die Eugenik und dann, ausführlicher, auf die verschiedenen Aspekte der Auslese ein.
An dieser Stelle muss noch erklärt werden, was genau ich unter den beiden behandelten Begriffen verstehe. Eugenik ist in meiner Definition der Versuch, das Erbgut einer Gruppe von Menschen positiv zu verändern, beispielsweise durch staatlich geregelten Geschlechtsverkehr. Unter Auslese verstehe ich jede politische Maßnahme, die Menschen nach bestimmten Kriterien auswählt und in verschiedene Gruppen einteilt, wie zum Beispiel die Rasseneinteilung im Dritten Reich. Diese Definitionen sind nicht als allgemeingültig zu verstehen, sondern nur als Richtlinien zum besseren Verständnis meiner Ausführungen.
II. Platon - Politeia
1. Allgemeine Einführung
In erster Linie ist Platons Hauptwerk Politeia nicht etwa ein politisches, sondern vielmehr ein philosophisches Werk. Die Frage, die in diesem Buch hauptsächlich behandelt wird, formuliert Sokrates, der Hauptgesprächsführer in dem Dialog, folgendermaßen: „ […], die Gerechtigkeit […], wie sollen wir es damit halten?“[1] Sokrates entschließt sich dazu, die Antwort dieser Frage über einen Umweg zu finden, nämlich indem er versucht, mit seinen Gesprächspartnern „von Anfang an eine Stadt [zu] gründen“[2] – selbstverständlich nur imaginär. Sokrates´ Plan geht auf, und schon im vierten (von zehn) Büchern findet er eine geeignete Formulierung für das Wesen der Gerechtigkeit, „nämlich daß [sic!] man das Seinige tut.“[3] Einige andere philosophische, vornehmlich erkenntnistheoretische und ontologische Gedanken tauchen in dem Werk auf, so zum Beispiel das berühmte Höhlen- oder Liniengleichnis; doch der Fokus liegt auf der imaginären Stadt, die Sokrates auf Drängen seiner Gesprächspartner immer weiter ausbaut. Auf die Frage von Glaukon, „ob es eine solche Verfassung überhaupt geben könne“[4], entgegnet Sokrates, dass er nur „ein Musterbild eines guten Staates entworfen“[5] habe. Dass es sich bei Platons Politeia um eine positive Utopie, eine sogenannte Eutopie, handelt, lässt sich nach dieser Formulierung kaum noch widerlegen.
Mit verfassungsrechtlichen Forderungen, die aus moderner Sicht für die gedankliche Entwicklung eines Idealstaates am wichtigsten wären, hält sich Platon zurück, dafür befasst er sich sehr ausführlich mit Dingen wie der Dichtungszensur, der Erziehung, des Gemeinbesitzes von Kindern und Frauen sowie der Auslese bei der Wahl des Königs. Letztere drei Aspekte werden in dieser Arbeit genauer beleuchtet.
2. Die Rolle der Eugenik in Platons Staat
Eine der zu Recht disputabelsten Forderungen Platons ist sein Postulat, durch staatlich geregelten Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau perfekte Kinder heranzuzüchten. Dass dieses Thema für Platon nicht gerade geringe Relevanz hat, sieht man daran, dass sich praktisch das gesamt fünfte Buch mit diesem Problem beschäftigt. Die Bevölkerung wird hierbei nach bestimmten Kriterien in gute Menschen und schlechte Menschen eingeteilt (was nicht zu Unrecht an die Rassenideologie der Nationalsozialisten erinnert), um dann „die besten Männer so häufig wie möglich den besten Frauen beiwohnen“[6] zu lassen, während den schlechteren Menschen entsprechend weniger Beischlaf gegönnt wird. Was sich in den Ohren eines modernen Mitteleuropäers schon unvorstellbar anhört, wird noch verschärft dadurch, dass alle geborenen Kinder „die dazu bestellten Behörden an sich“[7] nehmen. Daraufhin werden die guten Kinder „in ein Sammelhaus“8 gebracht, während die schlechten Kinder „in einem unzugänglichen und unbekannten Ort“8 untergebracht werden. Die Interpretation dieser Textstelle scheint eindeutig zu sein: Die schlechten Kinder werden ausgesetzt und somit praktisch umgebracht. Der Zweck dieser Maßnahmen ist, „das Geschlecht der Wächter rein [zu] erhalten“[8]. Zum besseren Verständnis: Unter Wächtern versteht Platon die Soldaten eines Staates; sie werden hinter den Philosophen als der zweithöchste Stand angesehen – später wird darauf noch näher eingegangen.
Es ist heutzutage wohl kaum noch möglich, über Platon zu schreiben, ohne gleichzeitig auf Karl Popper einzugehen, der sich mit seinem Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ als „einer der schärfsten Platonkritiker“[9] etabliert hat. Popper postulierte, dass Platons Ansichten unweigerlich zum Totalitarismus führen[10]. Ich werde an dieser Stelle kurz auf Poppers Werk eingehen, da sich darin einige erhellende Gedanken für meine Arbeit finden lassen. Im späteren Verlauf meines Aufsatzes werde ich ebenfalls ein paar Mal darauf zurückgreifen.
Laut Popper besteht die zentrale philosophische Lehre Platons in dem, was er einen pessimistischen Historizismus nennt: So sind in Platons Augen alle veränderlichen Dinge
dazu bestimmt, unterzugehen. Das gilt auch für jede Gesellschaftsordnung, weswegen
jede Veränderung im Staat denselben unweigerlich verdorbener macht[11]. Somit ist, wenn man Popper Glauben schenkt, jede der politischen Forderungen Platons letztlich auf seinen Wunsch zurückzuführen, einen unveränderlichen, quasi versteinerten Staat zu entwerfen, so auch die Eugenik: „Alle Pflanzen und Tiere, teilt er uns mit, müssen unter Beachtung bestimmter Zeitperioden gezüchtet werden, wenn Unfruchtbarkeit und Entartung vermieden werden sollen.“[12] Deshalb muss auch der Mensch wie ein Tier gezüchtet werden, damit er nicht entartet, und das macht die Eugenik notwendig.
Man wird sich bestimmt fragen, wie sich jemand mit solchen Ideen als einer der wichtigsten Philosophen aller Zeiten etablieren konnte. Man muss dabei die ethischen Unterschiede zwischen der hellenischen und der modernen westlichen Kultur beachten: Beispielsweise wurden im antiken Sparta einige der staatlichen Maßnahmen aus der Politeia tatsächlich praktiziert, unter anderem die kollektive Nachwuchserziehung und das Töten von offensichtlich schwachen Kindern[13]. Das kann man als Rechtfertigung für Platons Ansichten durchaus gelten lassen, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass solche Praktiken aus heutiger Sicht moralisch unbedingt zu verurteilen sind.
3. Stände, Auslese und Königswahl in der „Politeia“
3.1 Natürliche Veranlagungen und der Mythos der Erdgeburt
Platon geht davon aus, dass jeder Mensch determiniert ist durch bestimmte Anlagen, die seinen späteren Beruf bestimmen.[14] Wie bereits angedeutet wurde, ist diese Ansicht durchaus problematisch, da Platon aus der natürlichen Veranlagung eine Einteilung der Menschen hinsichtlich „gut“ und „schlecht“ ableitet, nämlich in drei Niveaus: Gold, Silber und Erz. Dies soll laut Platon den Bürgern in einer Geschichte dargebracht werden, nach der alle Menschen unter der Erde gebildet und jedem von ihnen eines der drei Metalle beigemischt wurde.[15] In der Fachliteratur wird diese Geschichte als Mythos der Erdgeburt[16] bezeichnet. Bei der Festlegung des vorherrschenden Metalls wird nicht auf die Eltern geachtet, sondern tatsächlich nur auf die Fähigkeiten des Individuums: „[...] man müsse, wenn den Wächtern ein untüchtiger Nachkomme geboren werde, diesen zu den anderen überführen, wenn aber den anderen ein tüchtiger, diesen unter die Wächter aufnehmen.“[17] Wie man sieht, wird ein durch Geburt festgelegter Adelsstand bewusst verworfen. Gleichzeitig wird hier das Konzept einer modernen „sozialen Mobilität“[18] entworfen. Jedoch hat Popper darauf hingewiesen, dass Platon diese Forderung später (auch in anderen seiner Werke) revidiert, indem er soziale Mobilität nur nach unten und nicht nach oben zulässt.[19]
Realisiert wird die qualitative Einteilung der Bürger durch eine genaue Überprüfung der Bürger im Jugendalter. Dabei werden die Heranwachsenden gemäß bestimmter Eigenschaften ausgesondert. Dies hat vor allem den Zweck, philosophisch veranlagte Menschen zu finden, die das Potential haben, später Herrscher zu werden. Die Jugendlichen sollten hierfür unter anderem mutig, gerecht und lernbegierig sein.[20] Wie genau die Herrscherwahl vonstatten geht, wird später näher erläutert.
3.2 Das Kastensystem in der Politeia
Platon teilt seine Bevölkerung ein in drei Stände: Die Philosophen, die Wächter und die Bauern und Handwerker. Letztere werden von Platon kaum behandelt, was vor allem von Popper kritisiert wird, der interpretiert, dass Platon die Bauern und Handwerkern nur als „menschliches Herdenvieh“[21] sieht, also analog zu Tieren als notwendige Ressource, um die man sich aber nicht weiter kümmern muss. Michael Arend hat diese Interpretation Poppers kritisiert, indem er darauf hingewiesen hat, dass „das Volk sich als Einheit fühlt und nach der Ideopragie-Formel, mit dem Seinigen zufrieden ist und durch die Ausprägung des entsprechenden Seelenteils das Dasein als Produzent anstrebt.“[22]
Die beiden anderen Stände, die Philosophen und die Wächter, werden dafür sehr genau behandelt – fast das ganze Werk handelt von der Wahl der ersteren und der Erziehung der letzteren. An die Wächter werden dabei nicht geringe Ansprüche gestellt: So sollten sie „weisheitsliebend (philosophisch), beherzt, begehend und stark von Natur“[23] sein. An anderer Stelle fordert Platon sogar, dass die Wächter „göttlich, soweit es den Menschen nur irgend möglich ist“[24] sein sollen. Man kann Popper verstehen, wenn er den Wächterstand in Hinblick auf diese Worte als „überlegene Herrenrasse“[25] beschreibt – die Parallele zu den nationalsozialistischen Ariern ist unverkennbar.
Die Philosophen sind laut Platon diejenigen, die die von ihm postulierte Ideenwelt sehen, also die unveränderlichen Dinge an sich, deren vergängliche Abbilder man mit den Sinnen wahrnimmt. Nur diese Philosophen sind zum Herrschen geeignet. Es ist verständlich, dass die Anforderungen an sie noch höher sein müssen als an die Wächter. Platon fordert von seinen Königen, „daß [sic!] sie ohne Falsch sind und sich, soweit es auf ihren Willen dabei ankommt, keinerlei Unwahrheit zuschulden kommen lassen, sondern die Unwahrheit hassen, die Wahrheit dagegen lieben.“[26] Popper hat gut erkannt, dass diese Stelle in auffälligen Gegensatz steht zu Platons Aufforderung, die Bürger durch Lügen und Täuschung bewusst zu manipulieren.[27] So schreibt Platon im dritten Buch: „Den Regenten also, wenn überhaupt irgend jemandem, kommt es zu, zum Nutzen der Stadt die Unwahrheit zu sagen, [...]“[28].
[...]
[1] I 331b. (Die Stellenangaben beziehen sich auf die übliche Stephanus-Paginierung der Politeia. Die Übersetzung stammt aus Apelt, Otto (Übers.): Platon. Der Staat, Köln 2010)
[2] II 369c.
[3] IV 433b.
[4] V 471d.
[5] V 472e.
[6] V 459d.
[7] V 460b.
[8] V460c.
[9] Iwan, Dominik: Der platonische Idealstaat – Fundament des Totalitarismus?, München 2009, S. 3.
[10] vgl. ebd., S. 4.
[11] vgl. Popper, R. Karl: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band 1: Der Zauber Platons, Tübingen 2003. Gesammelte Werke, Bd. 5, S. 25.
[12] Popper, R. Karl: a.a.O., S. 98.
[13] vgl. Gehring, Petra: Was ist Biomacht?: Vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens, Frankfurt am Main 2006, S. 156.
[14] vgl. II 374.
[15] vgl. III 415a ff.
[16] vgl. z.B. Canto-Sperber, Monique/Brisson, Luc: Zur sozialen Gliederung der Polis (Buch II 372d – IV 427c), in: Höffe, Otfried (Hrsg.): Platon, Politeia, Berlin 1997. Klassiker Auslegen, Bd.7, S. 83 f.
[17] IV 423c f.
[18] Canto-Sperber/Brisson, a.a.O., S. 84.
[19] vgl. Popper, R. Karl: a.a.O., S. 168.
[20] vgl. VI 486a ff.
[21] Popper, R. Karl: a.a.O., S. 57.
[22] Arend, Michael: Die Philosophenkönigherrschaft in Platons „Politeia“, München 2010, S. 30.
[23] II 376c.
[24] II 383c.
[25] Popper, R. Karl: a.a.O., S. 62.
[26] VI 485c.
[27] vgl. Popper, R. Karl: a.a.O., S. 165.
[28] III 389b.