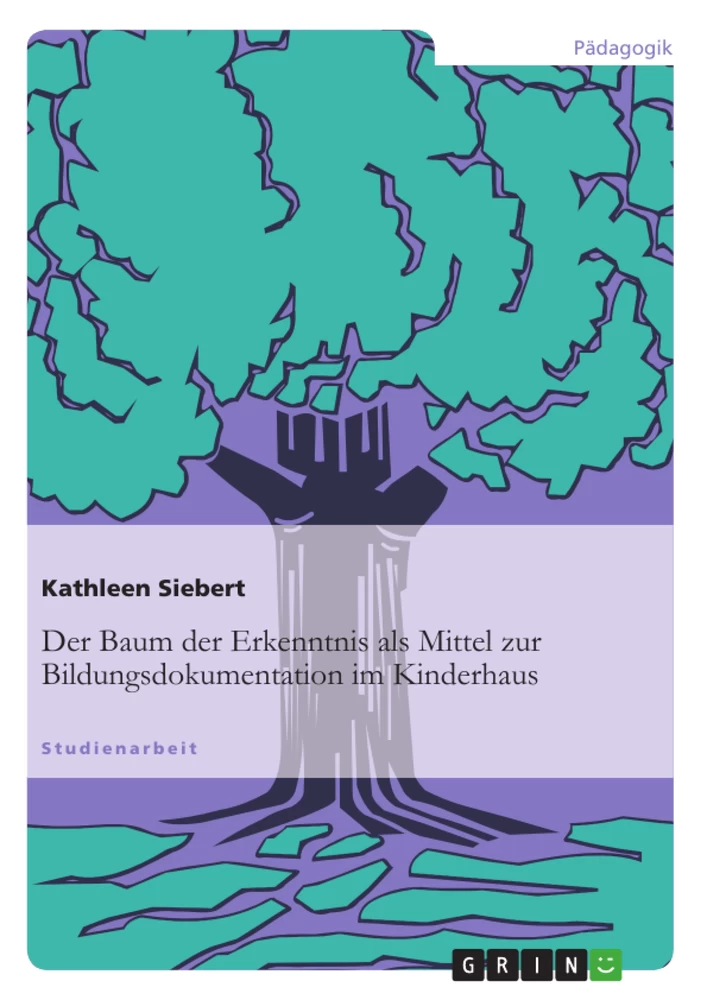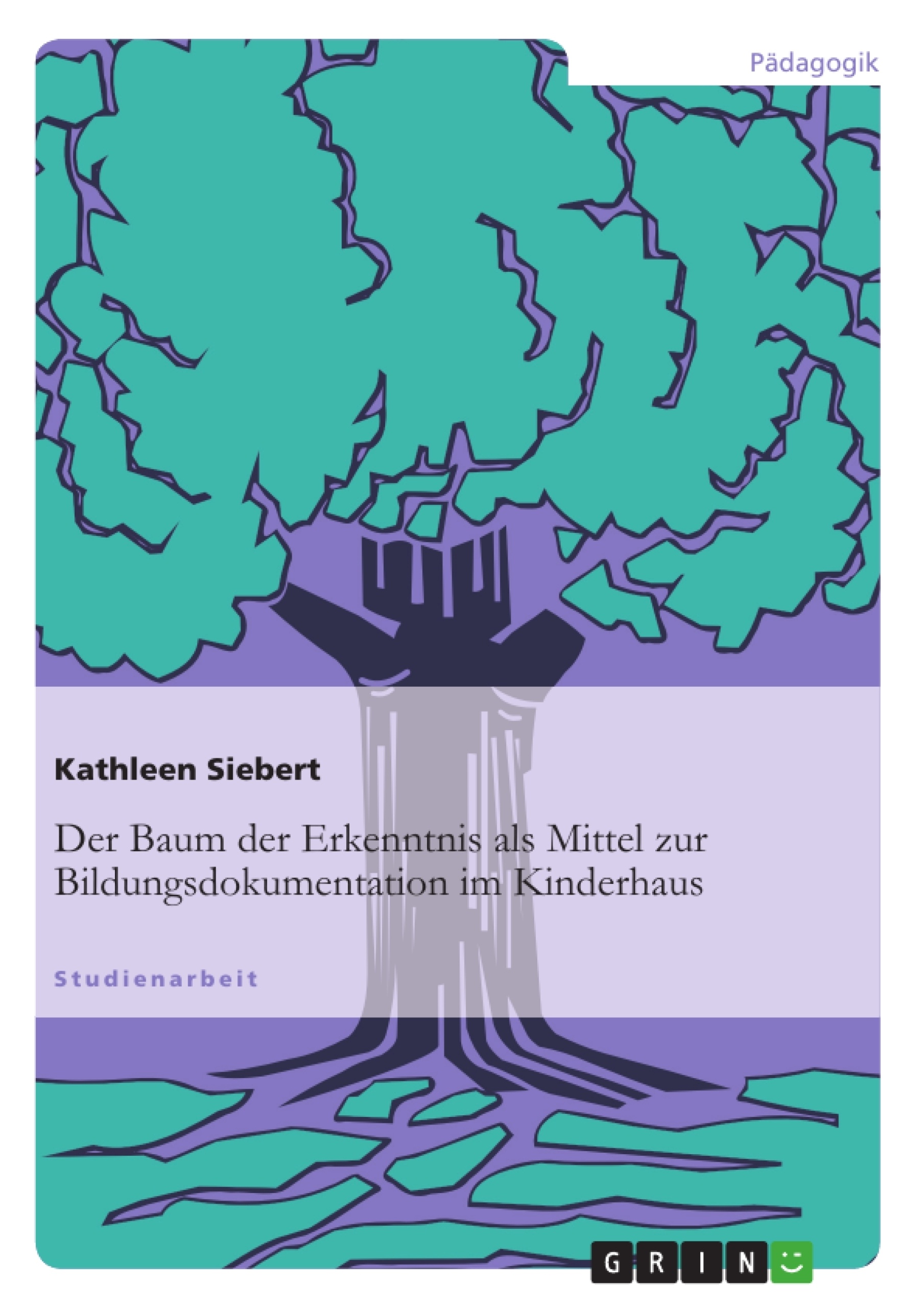Die bildungs- und entwicklungsfördernde Gestaltung der pädagogischen Arbeit durch Fachkräfte in den Kindereinrichtungen steht im Mittelpunkt aller Bildungspläne. Neben Betreuung und Erziehung der anvertrauten Kinder gilt es, gezielt Bedingungen zur Anregung von Bildungsprozessen zu schaffen. Der Bildungsweg von Kindern, die sich eigenaktiv die Welt aneignen wollen, soll durch eine individualisierte und differenzierte Erziehungsarbeit unterstützt, angeregt und gefordert werden.
Einen zentralen Stellenwert nehmen dabei Beobachtung und eine darauf aufbauende Bildungsdokumentation ein. Sie sind der Ausgangspunkt, um Kinder und ihre Lernprozesse zu verstehen und unterstützen zu können. Deshalb wird in aktuellen Qualitätshandbüchern und in den Bildungsplänen der Bundesländer der Beobachtung und Dokumentation kindlicher Bildungsprozesse als Teil fachlichen Handelns große Bedeutung beigemessen. Dabei gibt es unterschiedliche Aspekte kindlicher Entwicklungs- und Bildungsprozesse, welche mit verschiedenen Verfahren der systematischen Beobachtung und Dokumentation erfasst werden können.
Der "Baum der Erkenntnis", ein aus Halmstadt/Schweden stammendes Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren wurde von Marianne und Lasse Berger ins Deutsche übersetzt und hält mehr und mehr Einzug in deutschen Institutionen. Entwickelt wurde es, um die Entwicklung und das individuelle Lernen von Kindern und Jugendlichen vom ersten bis zum 16. Lebensjahr verfolgen zu können. In Auseinandersetzung mit dieser Methode kam für mich die Frage auf, inwieweit sie für den Kinderhausbereich geeignet ist, welche Vorteile sie bietet und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen.
Um dieser Frage nachzugehen wird in Teil eins zunächst auf die Bedeutung von Beobachtung und Dokumentation im Kinderhaus im Allgemeinen eingegangen. Teil zwei beschreibt den „Baum der Erkenntnis“ näher und geht auf die Besonderheiten dieses Instrumentes und auf Chancen und Möglichkeiten für pädagogisches Handeln ein. Abschließend stellt Teil drei Überlegungen zur Implementierung in die Praxis an.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Beobachtung und Dokumentation im Kinderhaus - warum?
1.1 Notwendigkeit von gezielter Beobachtung und Dokumentation
1.2 Zielrichtungen von Beobachtungen - Unterschiedliche Perspektiven auf
das Kind
1.3 Einfluss auf pädagogisches Handeln
2 Der Baum der Erkenntnis - ein Instrument für Beobachtung und Dokumentation
2.1 Entstehungsgeschichte
2.2 Die ganzheitliche Sicht
2.3 Chancen und Möglichkeiten für pädagogisches Handeln
3 Überlegungen zur Implementierung in die Praxis
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis