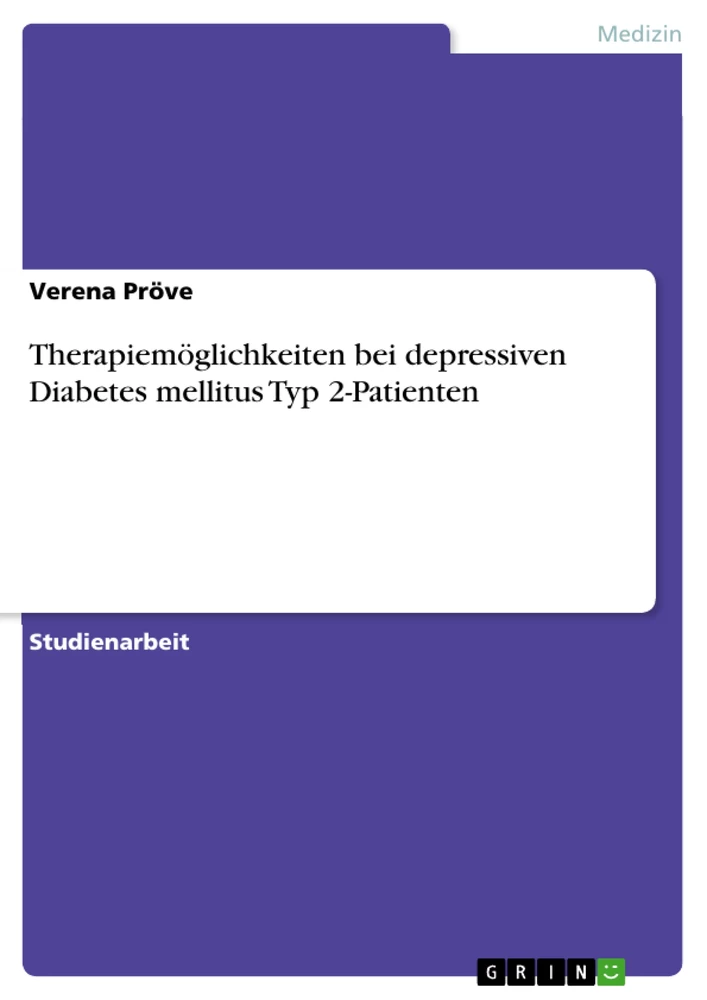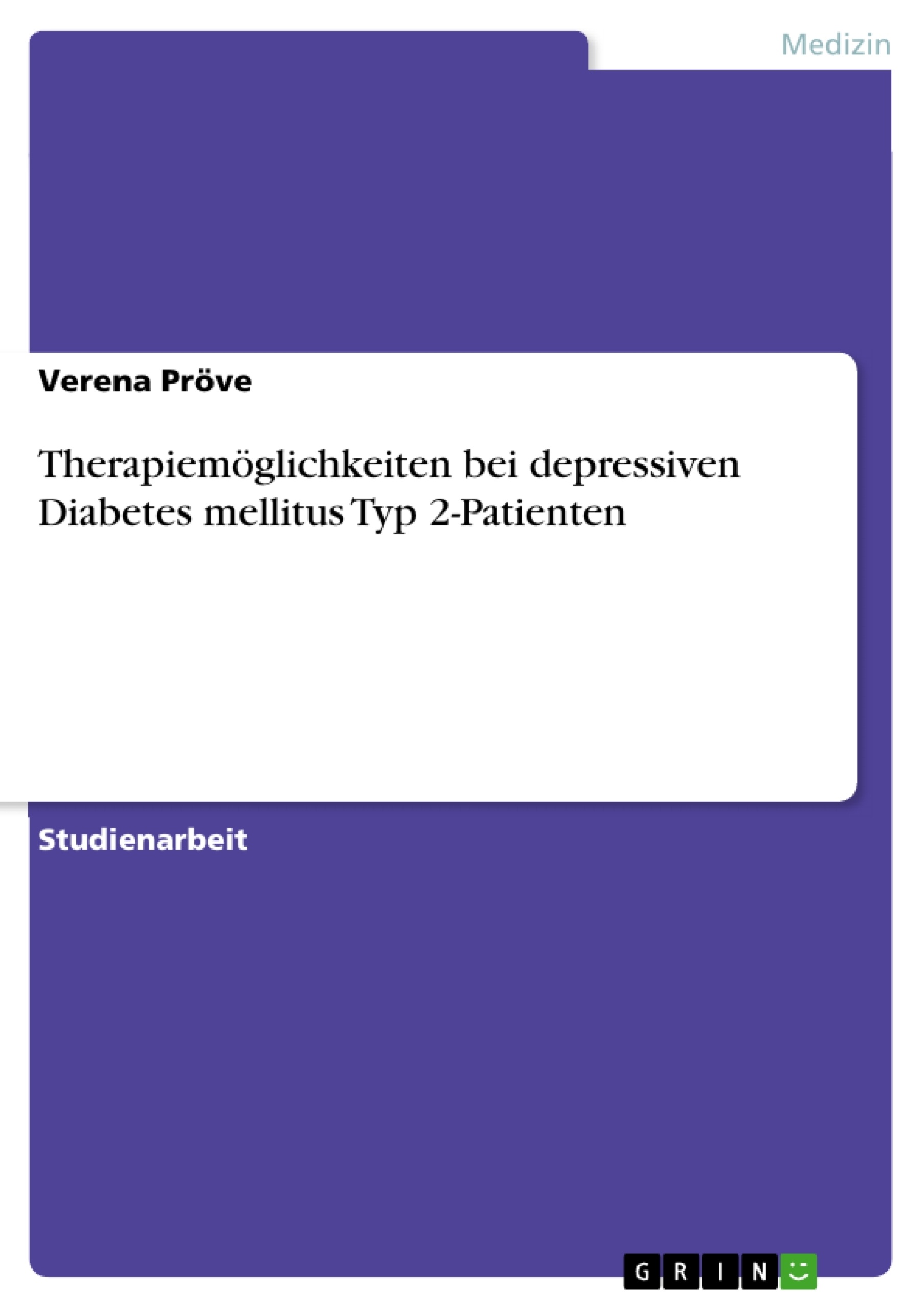[...] Meine Arbeit beginnt einführend mit einer Kurzdefinition des Diabetes mellitus Typ 2 im
ersten Kapitel. Hier soll ein Einblick darüber vermittelt werden, was genau das Krankheitsbild
im Organismus des menschlichen Körpers auslöst und wie sich die Symptomatiken
äußern. Im Kapitel drei werde ich das Krankheitsbild der Depression genauer
erläutern. Dabei werde ich näher darauf eingehen, was genau eine Depression ist und
wie diese in der Medizin unterteilt wird. Weiterhin gebe ich einen Überblick über theoretische
Überlegungen zur Krankheitsentstehung. Abschließend zeige ich die Häufigkeiten
von Depressionen bei Diabetes mellitus Patienten auf. Im vierten Abschnitt habe
ich mit dem Begriff der Komorbidität und der Auswirkung von zwei bestehenden chronischen
Erkrankungen beschäftigt. Nach einer kurzen Definition des Begriffes werde
ich aufzeigen, dass psychische Komorbidität gerade bei Diabetikern kein Einzelfall ist.
Im fünften Kapitel erkläre ich Therapieansätze und ihre Folgen bei depressiven Diabetes
mellitus Patienten. Zunächst gehe ich näher auf angewandte Diabetes mellitus-
Therapieformen ein und erkläre anschließend, wie sich diese auf die Psyche des Patienten
auswirken können. Daraufhin stelle ich dar, was es für spezielle Möglichkeiten
zur Therapie bei depressiven Diabetikern gibt. In diesem Zusammenhang werde ich
mich mit der Thematik beschäftigen, ob Möglichkeiten bestehen, beide Krankheiten
zugleich behandeln zu können bzw. was es genau für einzelne Therapieformen gibt,
die beide Krankheitsverläufe positiv beeinflussen. Zum Ende des Kapitels erkläre ich weiterhin die Effektivität einer Diabetes mellitus Behandlung bei gleichzeitigem Vorhandensein
einer Depression. In einem abschließenden Fazit greife ich meine Fragestellung
„Kann eine Diabetes mellitus-Therapie eine Depression hervorrufen?“ erneut
auf. Ich zeige mögliche Lösungsansätze als Resultat der zuvor behandelten Themenbereiche
auf.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kurzdefinition zum Diabetes mellitus Typ 2
3. Depressionen bei Diabetes mellitus Typ 2 Patienten
3.1. Definition der Krankheit Depression
3.2. Theorie zur Entstehung einer Depression bei Diabetikern
3.3. Häufigkeiten von Depressionen bei Diabetikern
4. Das Zusammenwirken zweier chronischen Erkrankungen
4.1. Definition von Komorbidität
4.2. Auswirkungen psychischer Komorbidität bei Patienten mit Diabetes mellitus
5. Therapieansätze und ihre Folgen
5.1. Formen der Diabetes mellitus- Therapie
5.2. Auswirkungen der Diabetes mellitus- Therapie auf die Psyche
5.3. Spezielle Therapieformen bei depressiven Diabetikern
5.4. Effektivität der Diabetes mellitus Behandlung bei Depressionen
6. Ausblick und Fazit
Literaturverzeichnis