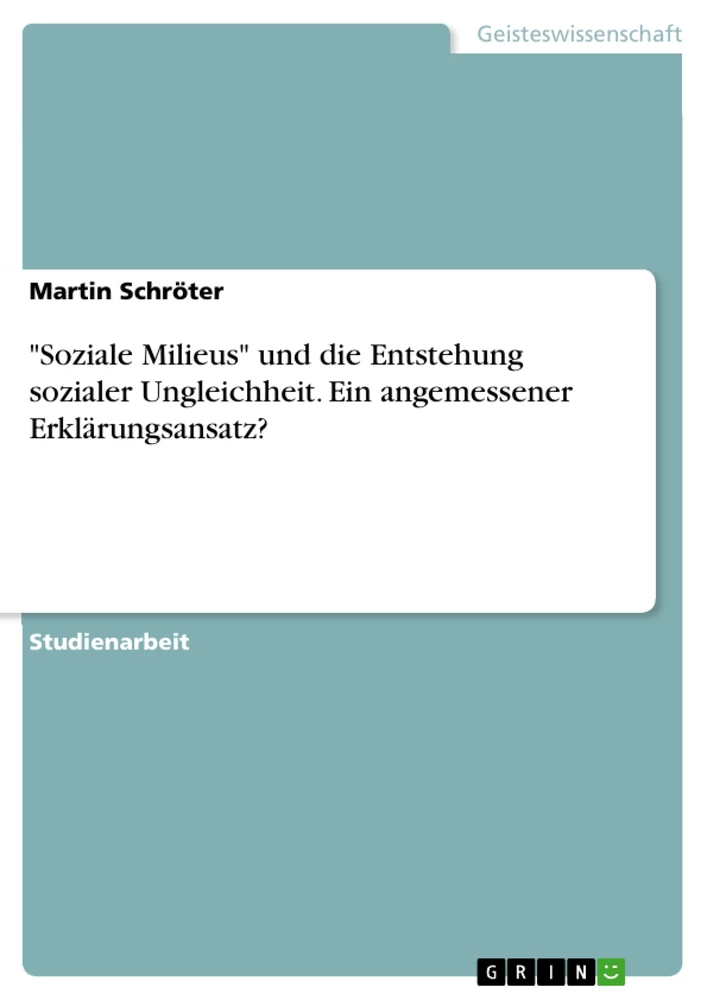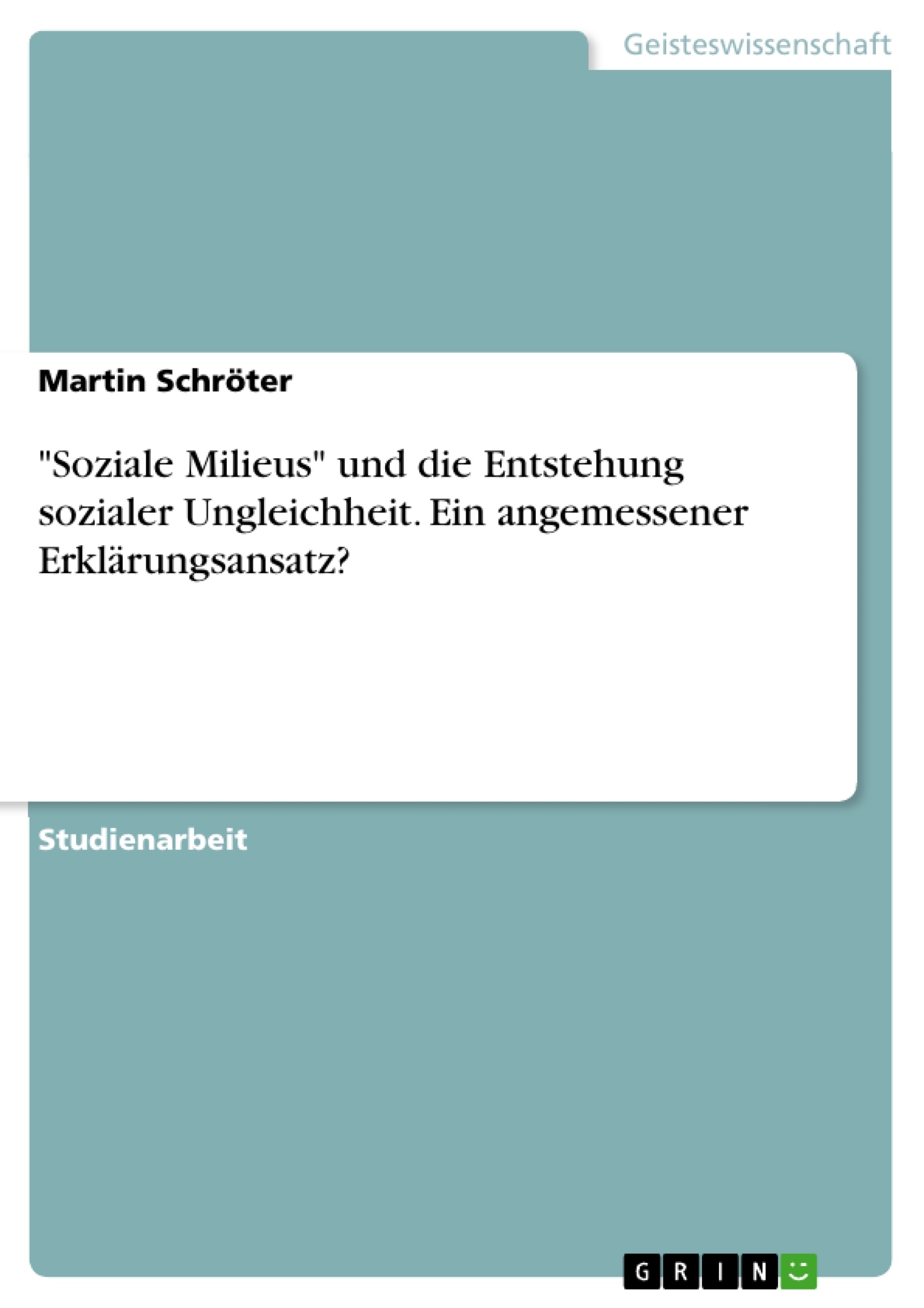Soziale Ungleichheit gab es vermutlich in allen Gesellschaften und zu jeder Zeit. Seit ihrer Entstehung setzen sich daher die Sozialwissenschaften und im speziellen die Ungleichheitsforschung mit sozialer Ungleichheit auseinander.
Bis heute wurden zahlreiche Theorien und Ansätze entwickelt, die die Entstehung sozialer Ungleichheit insbesondere durch verschiedene Begriffe wie Klassen, Stände und Schichten zu erklären vermögen. Dabei beschäftigen sie sich vor allem mit den objektiven, das heißt äußeren Bedingungen sozialer Ungleichheit wie Einkommen, Bildung und Beruf. Eine andere Perspektive schlägt der Ansatz der „sozialen Milieus“ vor, der – aufbauend auf den Ideen des Soziologen Pierre Bourdieus – die subjektive Seite sozialer Ungleichheit untersucht. Seine Grundannahme ist, dass soziale Ungleichheit – zwar durchaus abhängig, aber weniger von objektiven Faktoren wie Einkommen, Bildung und Beruf entstehe, sondern vielmehr durch milieuspezifische Lebensstile, ‚Geschmäcker’ und Mentalitäten.
In wie weit der Milieuansatz, der sich insbesondere seit den 1980er Jahren in der sozialwissenschaftlichen Debatte in Deutschland durchgesetzt hat, als ein angemessenes Instrument zur Erklärung sozialer Ungleichheit darstellt, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.
Dazu wird zunächst der Begriff ‚soziale Ungleichheit’ definiert und dargestellt, was seine grundlegenden Problematiken sind. Anschließend folgt ein historischer Überblick über die wichtigsten Theorien und Ansätze zur Erklärung sozialer Ungleichheit in Deutschland.
Es folgt im Rahmen dieser Diskussion die Vorstellung des Milieuansatzes und dessen Beitrag zur Erklärung sozialer Ungleichheit, die insbesondere auf der Kapital- und Habitustheorie Bourdieus beruhen. Anschließend werden die Anwendungsmöglichkeiten des Milieuansatzes, dessen Stärken und Schwächen diskutiert und seine Möglichkeiten zur Erklärung sozialer Ungleichheit im Kontext der aktuellen Entwicklungen in Deutschland resümiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Soziale Ungleichheit
2.1 Definition
2.2 Theorien sozialer Ungleichheit: Klassen, Stände und Schichten
3. Soziale Milieus
3.1 Definition und Grundannahmen
3.2 Entstehung sozialer Milieus
3.3 Anwendung und Empirie
3.4 Kritik
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis