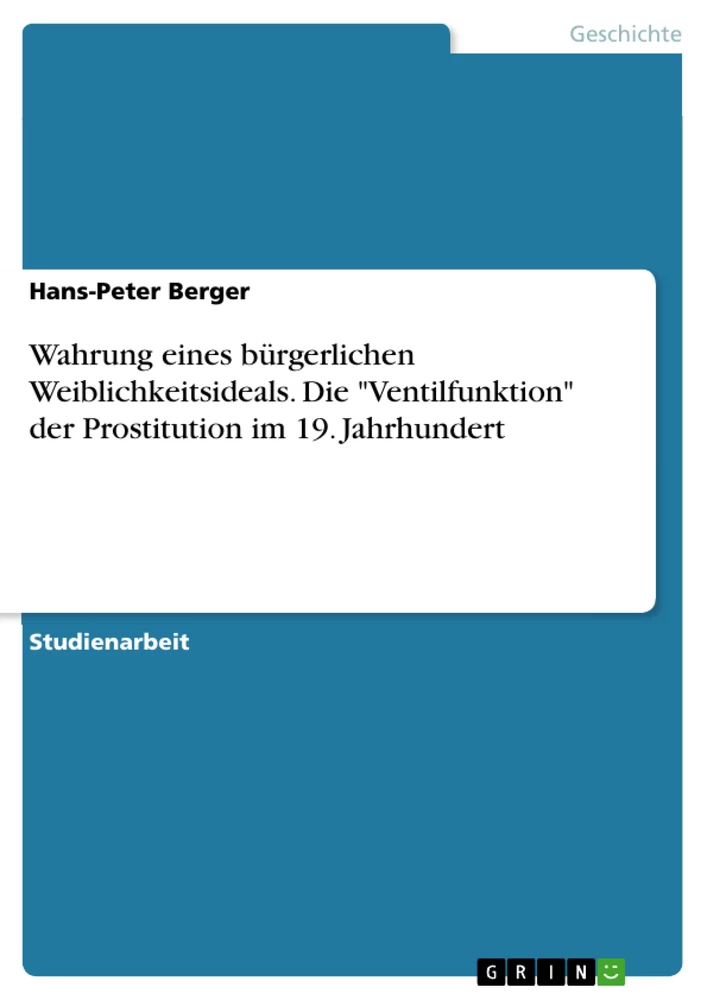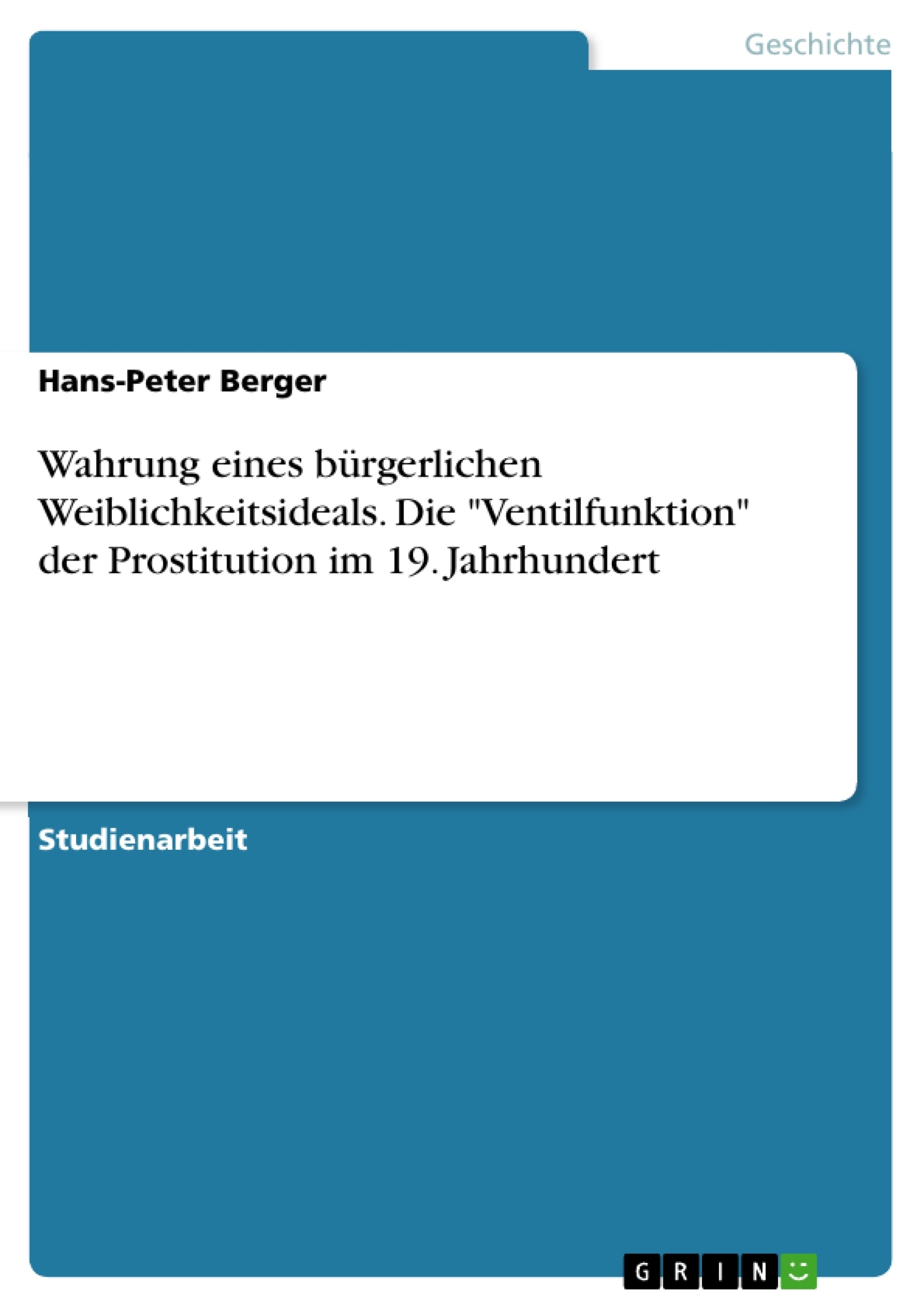Wenn man sich mit der Prostitution im 19. Jahrhundert beschäftigt sieht man sich einer Reihe angrenzender Problemfelder gegenüber. Neben den sozialen Fragen, welche unter anderem den Wohnungs- und Städtebau, sowie die dazugehörigen hygienischen Umstände betreffen, sowie auch die Thematik der Arbeits- und Lohnverhältnisse in den Fabriken dieser Zeit. Dazu kommen juristische und medizinische Fragen, die vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kontrovers diskutiert wurden. Einig war man sich fast immer darüber, dass es sich bei der Prostitution um ein gesellschaftliches Übel handelte, welches man beseitigen müsse. Über die Frage des „Wie?“ herrschte allerdings Uneinigkeit.
Neben den eben angesprochenen Thematiken wirft die Auseinandersetzung mit der Prostitution jener Zeit aber auch einen erhellenden Blick auf das herrschenden Bild die Frauen betreffend. Die Klasse des Bürgertums hatte einen Moralkodex und ein Geschlechterbild, mit denen sie sich nach oben und unten hin abzugrenzen versuchte. In diesen Vorstellungen war die Differenzierung von Mann und Frau mit den dazugehörigen Fähigkeiten und Pflichten eine gesellschaftstragende. Der bürgerlichen Vorstellung, wie eine Frau zu sein hatte, stand die Prostituierte als Gegensatz gegenüber. Sie verkörperte alles, was einer tugendhaften Frau schadete.
Schon allein die Tatsache, dass es vor allem Männer eben jener Klasse waren, welche sich moralisch über die Prostituierten stellte, die deren Dienste in Anspruch nahmen, zeigt diese Lücke. Mit den Vorstellungen über Moral wird auch ein Blick auf die bürgerlichen Vorstellungen geworfen, wie eine bürgerliche Frau zu sein hat und wie eben jene Moral das Geschlechterverhältnis bestimmte.
Der erste und zweite Punkt dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Bürgertum und seiner Moralvorstellung, sowie mit dem Bild der Frau, welches man zu dieser Zeit hatte. Gemeint ist das Bild der bürgerlichen Frau. Anschließend wird die Prostitution zu dieser Zeit untersucht. Woher kamen die Prostituierten, welche Rechte hatten sie, sind Punkte, die nur umrissartig behandelt werden können. Der Hauptteil beschäftigt sich mit den vorherrschenden Moralvorstellungen, die mit dem Problem der Prostitution einhergingen. Hier wird vor allem auf die Doppelmoral sowie die Ventilfunktion der Prostitution zur Wahrung bürgerlicher Moral und bürgerlicher Weiblichkeitsvorstellung hingewiesen werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bürgertum und bürgerliche Moral des 19. Jahrhunderts
3. Die Frau in der bürgerlichen Gesellschaft
4. Die „Antifrau“ - Die Prostituierte in der bürgerlichen Gesellschaft
4.1 Gründe für Prostitution
4.2 Die Rechte der Prostituierten
4.3 Bürgerliche Sexualmoral und Prostitution
5. Doppelmoral und Ventilfunktion
6. Fazit
7. Quellen
8. Literatur