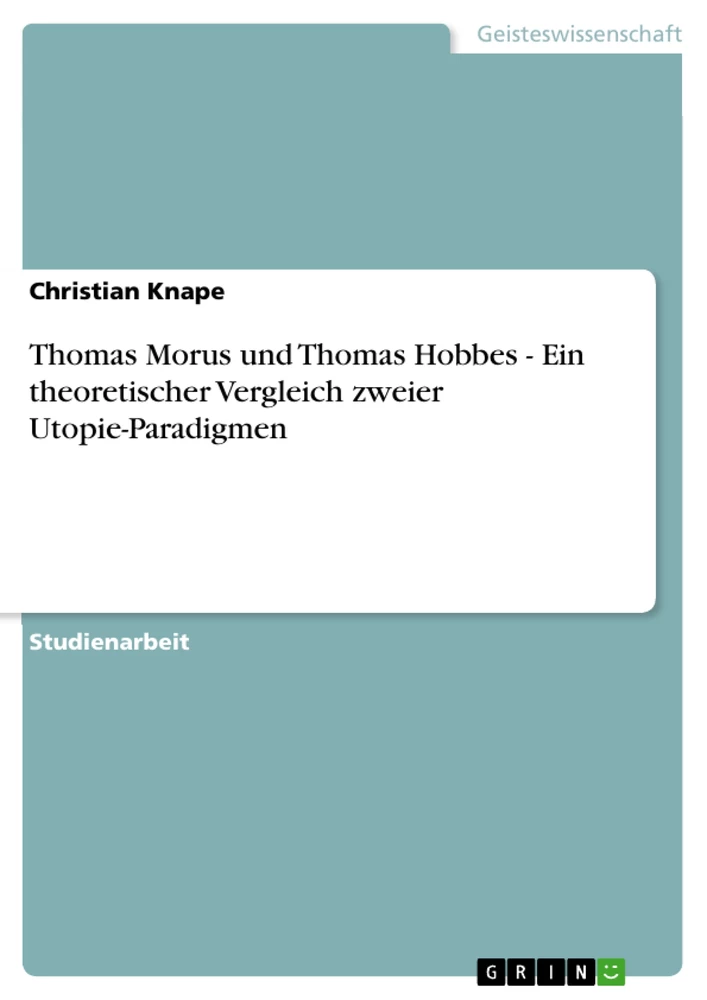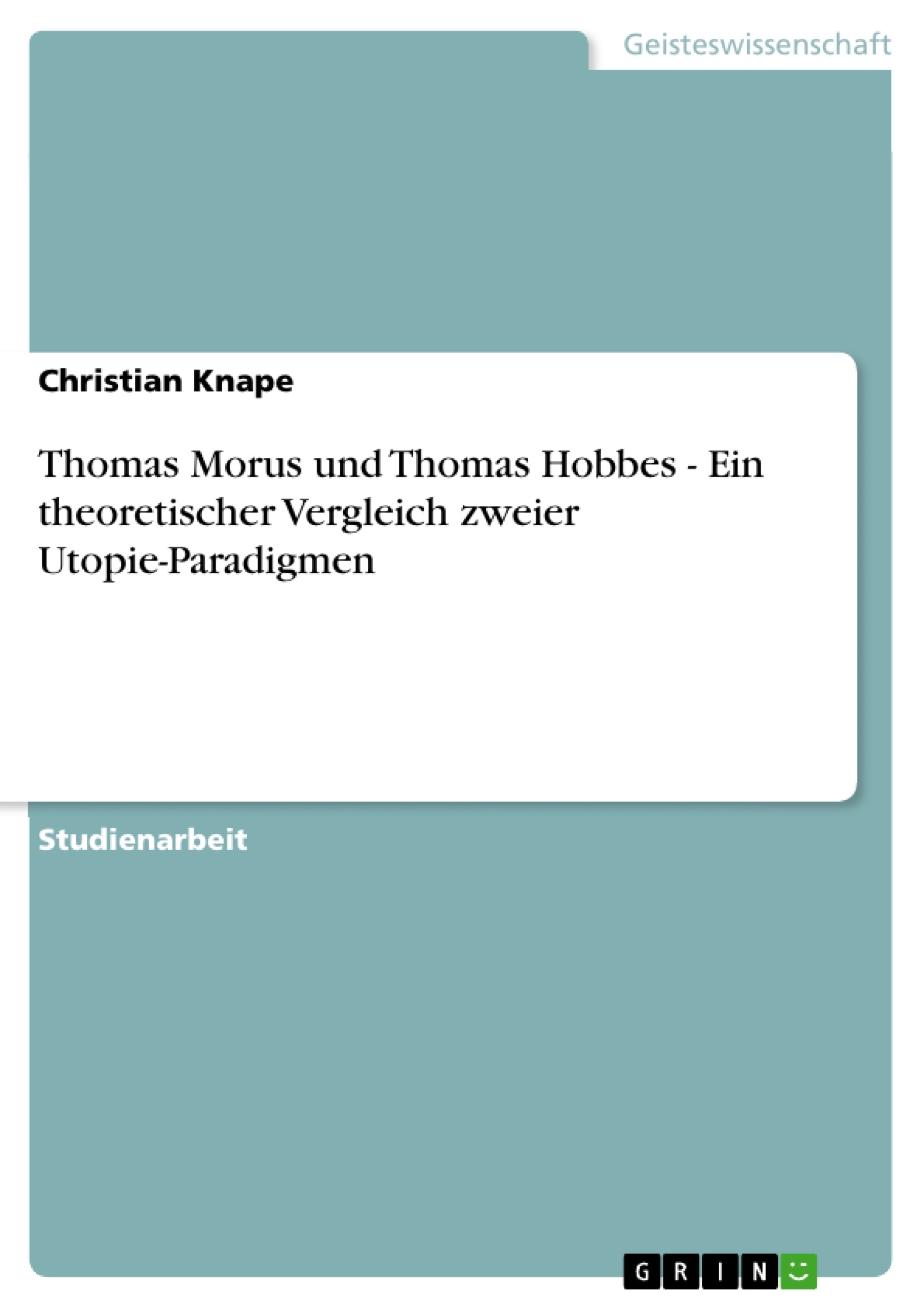In der vorliegenden Ausarbeitung sollen, ausgehend von einer allgemeinen Definition über den Begriff der „Politischen Utopie“, Morus' Utopie und Hobbes' Leviathan miteinander verglichen werden. Der Begriff der Utopie im Kontext der Ausführungen orientiert sich an spezifisch politischen Kontexten, da diese Abstraktion für die Ausarbeitung in einem begrenzten erkenntnistheoretischen Rahmen von ca. zwanzig Seiten unerlässlich ist. Anhand einer kategorialen Eingrenzung werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgezeigt, um wissenschaftlich verwertbare Aussagen im Zuge dieser Analyse herauszustellen.
Ausgehend von den vielfältigen politischen, wirtschaftlichen und religiösen Krisen der anbrechenden Neuzeit präsentieren Morus und Hobbes in ihren Werken fiktive und radikale Lösungsmöglichkeiten.
Der Autor hat sich dafür entschieden, ausgehend vom Staatsaufbau beider Autoren die Kategorie (a) der Anthropologie des Menschen und (b) der Eigentumsverhältnisse sowie der (c) religiösen Gesinnungs-/Erziehungsfreiheit vergleichend zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung und Zielformulierung
1. Die Neuzeit als Krisenerscheinung
2. Der Begriff der Politischen Utopie
3. Analytischer Vergleich
3.1 Mensch, Eigentum und Religion auf der Insel Utopia
3.2 Mensch, Eigentum und Religion im Körper des Leviathans
3.3 Zusammenfassung
4. Fazit
Literaturverzeichnis