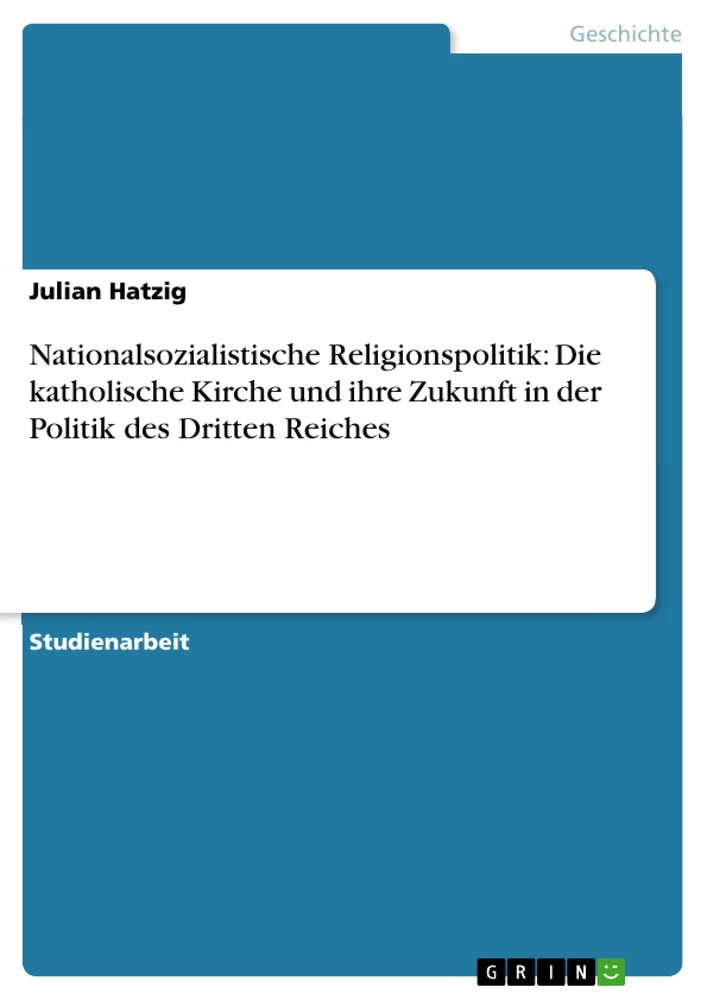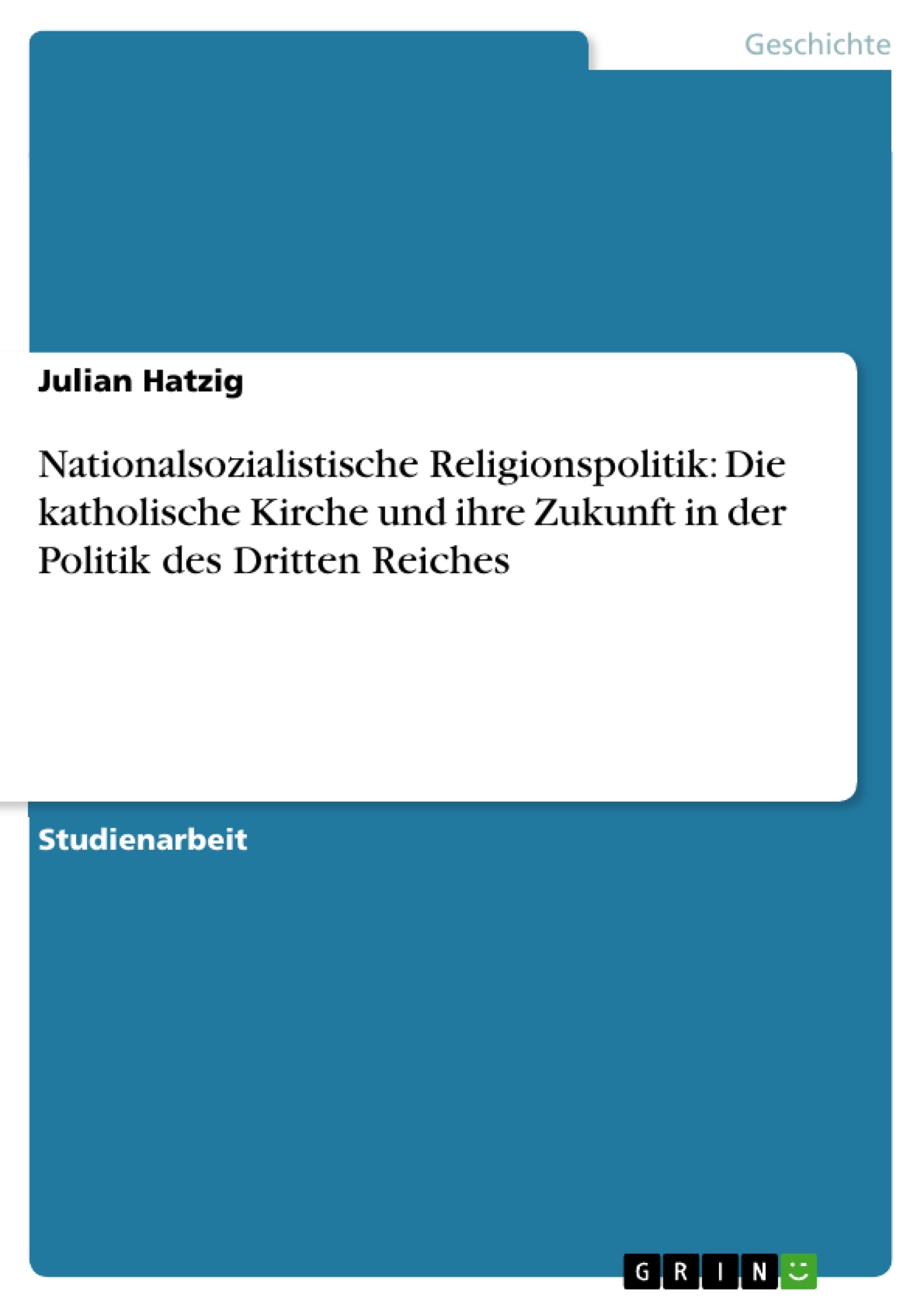„Mit den Konfessionen, ob nun diese oder jene: das ist alles gleich. Das hat keine Zukunft mehr. Für die Deutschen jedenfalls nicht. Der Faschismus mag in Gottes Namen seinen Frieden mit der Kirche machen. Ich werde das auch tun. Warum nicht? Das wird mich nicht abhalten, mit Stumpf und Stiel, mit allen Wurzeln und Fasern das Christentum in Deutschland auszurotten (…) Die katholische Kirche ist schon etwas Großes. (…) Doch nun ist ihre Zeit um! Das wissen die Pfaffen selbst. Klug genug sind sie, das einzusehen und sich nicht auf einen Kampf einzulassen. Tun sie es doch, ich werde bestimmt keine Märtyrer aus ihnen machen. Zu simplen Verbrechern werden wir sie stempeln. Ich werde ihnen die ehrbare Maske vom Gesicht reißen. Und wenn das nicht genügt, werde ich sie lächerlich und verächtlich machen.“
Dieses angebliche Zitat Hitlers, ist dem Werk des kurzzeitigen NSDAP Mitgliedes, Hermann Rauschning, „Gespräche mit Hitler“ aus dem Jahre 1940 zu entnehmen. Zwar bestehen seit 1984 bekanntermaßen erhebliche Zweifel an der Authentizität dieses Buches, welche soweit gehen, dass es als „dreiste“ Fälschung bezeichnet wird, jedoch stellt sich auch die Frage, ob in den vermeintlichen Zitaten Hitlers nicht doch ein Funke Wahrheit steckt. Kann es nicht sein, dass sie eine zeitgenössische Tatsache aufgreifen und in gewisser Weise widerspiegeln? Obwohl es in der folgenden Arbeit nicht darum gehen soll, sich intensiv mit dem Wahrheitsgehalt von Rauschnings Werk auseinanderzusetzen, liefert das oben aufgeführte Zitat doch einen Denkanstoß bezüglich der Zukunftsperspektive der nationalsozialistischen Religionspolitik. Während zahlreiche politische Bereiche des dritten Reichs, wie die Geo-, Wirtschafts- oder Baupolitik, aus heutiger Sicht vergleichsweise genaue Ziele und Vorstellungen auf diesem Gebiet liefern, gestaltet sich dies bei dem Thema Religionspolitik schwieriger. Aus diesem Grund wird die Arbeit der Frage nachgehen, welchen politischen Kurs die NSDAP bzw. die Nationalsozialisten bezüglich des Christentums verfolgten und welche religiösen Vorstellungen in der Bewegung vorherrschten. Um den vorgegeben Rahmen der Arbeit einhalten zu können, werde ich mich diesbezüglich nur mit einer der beiden christlichen Kirchen, nämlich der katholischen Kirche, beschäftigen. Ausgehend von den gemachten Erkenntnissen können anschließend Aussagen über die Zukunftsperspektive der nationalsozialistischen Religionspolitik getroffen werden.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Die Zeit der Weimarer Republik
II. 1 Die Katholische Kirche und die NS Kirchenpolitik
II. 2 Die Reaktion der Katholischen Kirche
III. Die Zeit in der Diktatur
III. 1 NS Katholizismuspolitik vor dem Reichskonkordat
III. 2 Das Reichskonkordat und seine Folgen
IV. Abschließende Bemerkungen und Fazit
V. Literaturverzeichnis
VI. Quellenverzeichnis