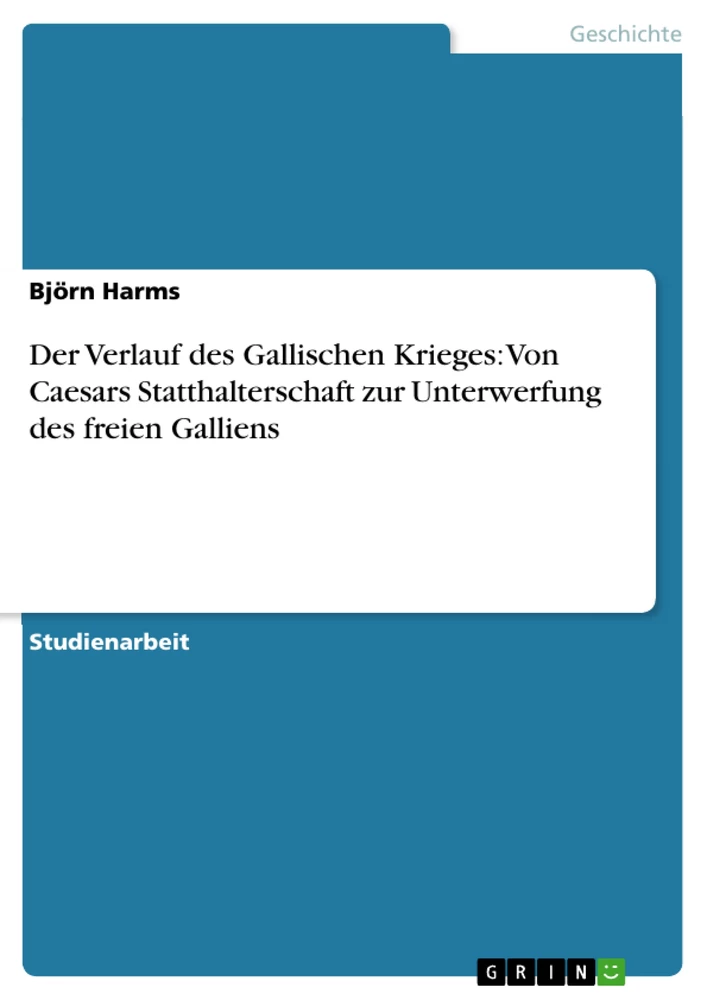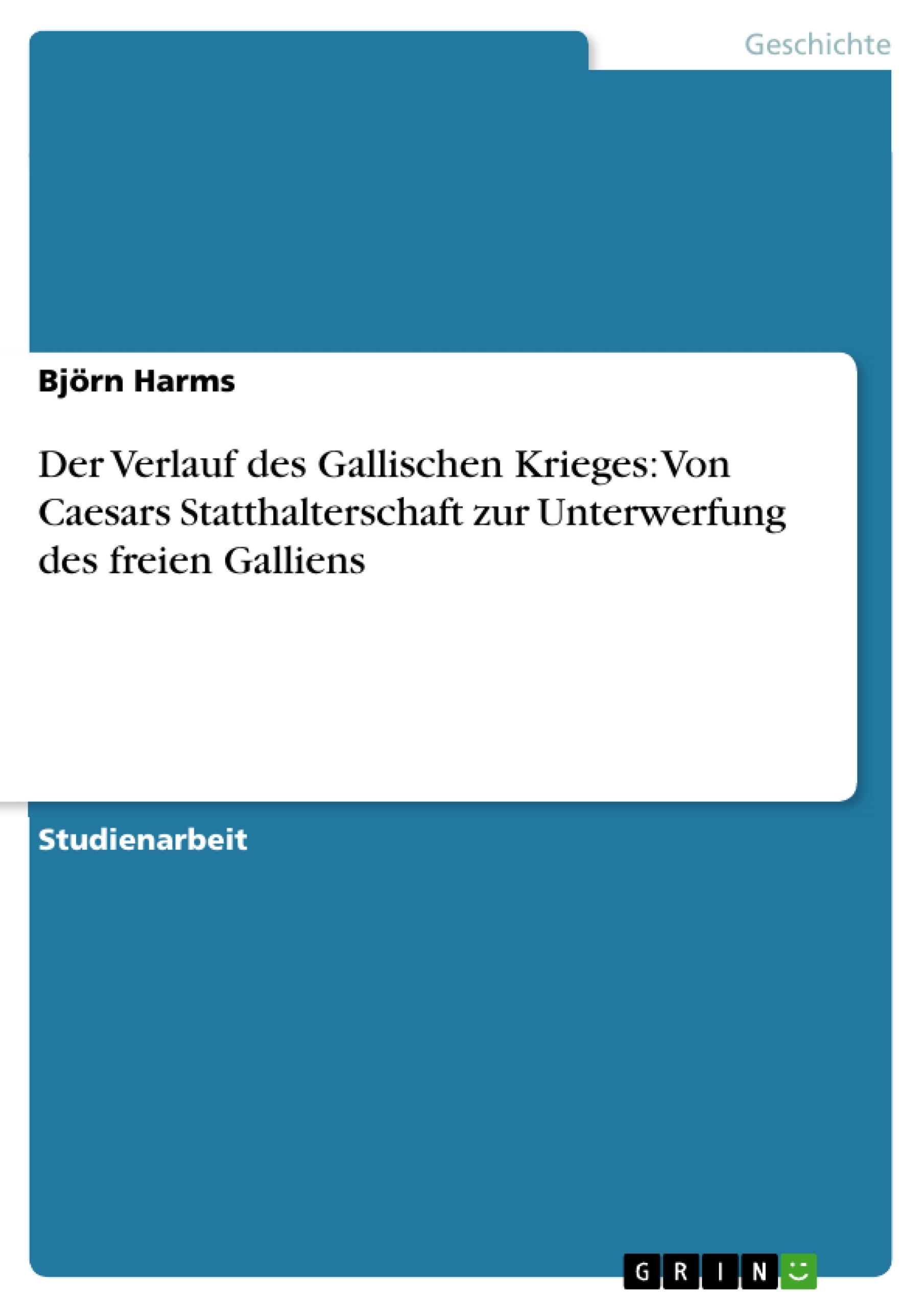Der Gallische Krieg – allgemein bekannt als die Unterwerfung des freien Galliens durch die Römer, personell verbunden vor allem mit einer zentralen Person. Gaius Julius Caesar hatte bis dato mehrfach sein rhetorisches und politisches Können in Rom unter Beweis gestellt. Aufgrund seiner umfassenden Bündnispolitik war er bis zum Konsul aufgestiegen. In militärischer Hinsicht hatte er jedoch erst marginale Erfolge erzielt. Gerade durch das militärische Leistungsvermögen definierte sich aber in den Augen der Römer eine wahrhaft große Persönlichkeit. Caesar wusste dies, und wollte er die großen Männer dieser Zeit wie Gnaeus Pompeius Magnus und Marcus Crassus an Ansehen überragen, musste es alsbald zu einem Krieg unter seinem Kommando kommen.
Nach römischer Tradition schloss sich einer Konsulatschaft die Statthalterschaft über eine oder mehrere Provinzen an. Caesar wurden schließlich dank Mithilfe seines Schwiegervaters die Provinzen Gallia Cisalpina, Illyrien und später auch Gallia Narbonensis zugesprochen.1 Letztere sollte der zentrale Ausgangspunkt für Caesars folgenden Eroberungsfeldzug werden.
Zusätzlich zur möglichen Steigerung des Ansehens durch kriegerische Erfolge sah Cäsar eine Möglichkeit durch Kriegsbeute seine klammen Kassen zu sanieren, denn er war zu diesem Zeitpunkt hoch verschuldet. Zwar waren in den östlichen Provinzen mehr Reichtümer zu erwarten, doch hatte hier bereits Pompeius viele Kriege geführt.
Viele Details und biographische Hintergründe müssen in der folgenden Seminararbeit außer Acht gelassen werden, um die vorgegebene Länge der Arbeit einzuhalten. Trotzdem soll die Zeit des gallischen Krieges nach wissenschaftlichem Standard aufgearbeitet werden und dem Leser ein guter Überblick über die kriegerischen Auseinandersetzungen von 58 v. Chr. – 50 v. Chr. geboten werden.
Inhaltsangabe
1. Einleitung
2. Quellenlage
3. Gallien am Vorabend der römischen Eroberungen
4. Der Gallische Krieg – Verlauf
4.1 Die Wanderung der Helvetier
4.2 Der Kampf gegen Ariovist
4.3 Die Verschwörung der Belgier
4.4 Die Britannienfeldzüge
4.5 Ambiorix und seine Flucht
4.6 Der Gallische Aufstand unter Vercingetorix
5. Fazit
Bibliographie