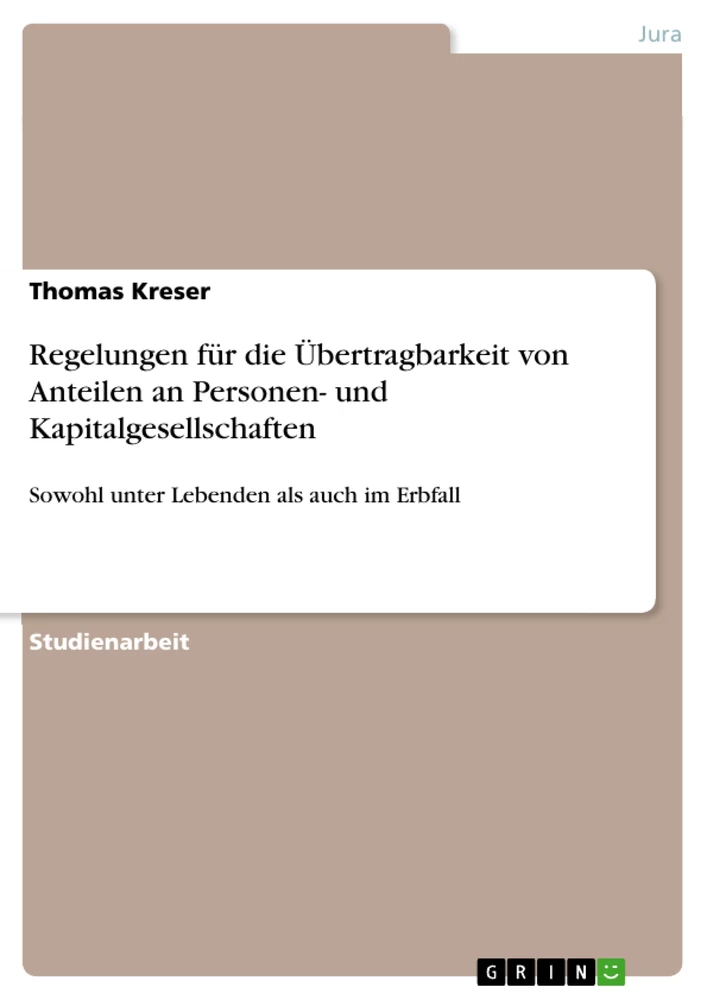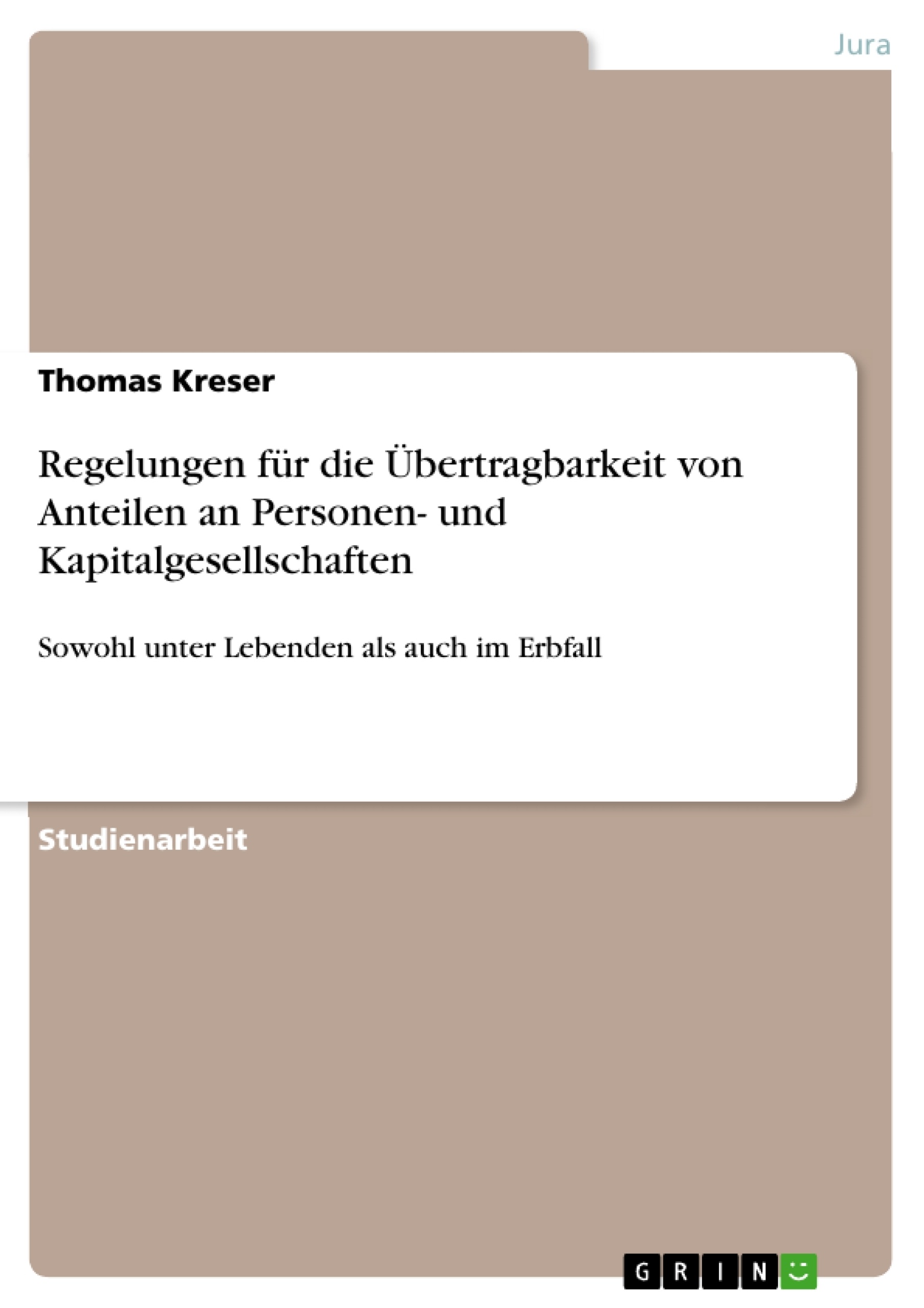Neben der Gründung eines Unternehmens ist die Nachfolgeregelung die wichtigste Entscheidung, die ein Unternehmer zu treffen hat.
Deshalb ist eine frühzeitige Regelung der Nachfolge für einen reibungslosen Übergang des Unternehmens auf die Nachfolger ebenso wichtig wie für den Fortbestand des Unternehmens selbst.
Die Arbeit gibt einen kurzen Überblick über die rechtlichen Regelungen, die dabei zu beachten sind.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Anteilsübertragung auf Grundlage des Erbrechts und sich daraus ergebende Gestaltungsmöglichkeiten
2.1 Erbrechtliche Grundlagen
2.1.1 Gesetzliche Erbfolge (§§ 1922-1936 BGB)
2.1.2 Gewillkürte Erbfolge
2.1.3 Das Pflichtteilsrecht
3. Anteilsübertragung im Rahmen der Unternehmensnachfolge
3.1 Einflussfaktoren auf die Gestaltung der Unternehmensnachfolge
3.2 Regelungen für Einzelunternehmen
3.3 Regelungen für Personengesellschaften
3.3.1 Gesellschaft bürgerlichen Rechts
3.3.2 Personengesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG)
3.4 Regelungen für Kapitalgesellschaften
3.4.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH
3.4.2 Aktiengesellschaft (AG)
3.4.3 Übersicht über die Regelungen für die wichtigsten Gesellschaftsformen
4. Resümee
5. Literaturverzeichnis