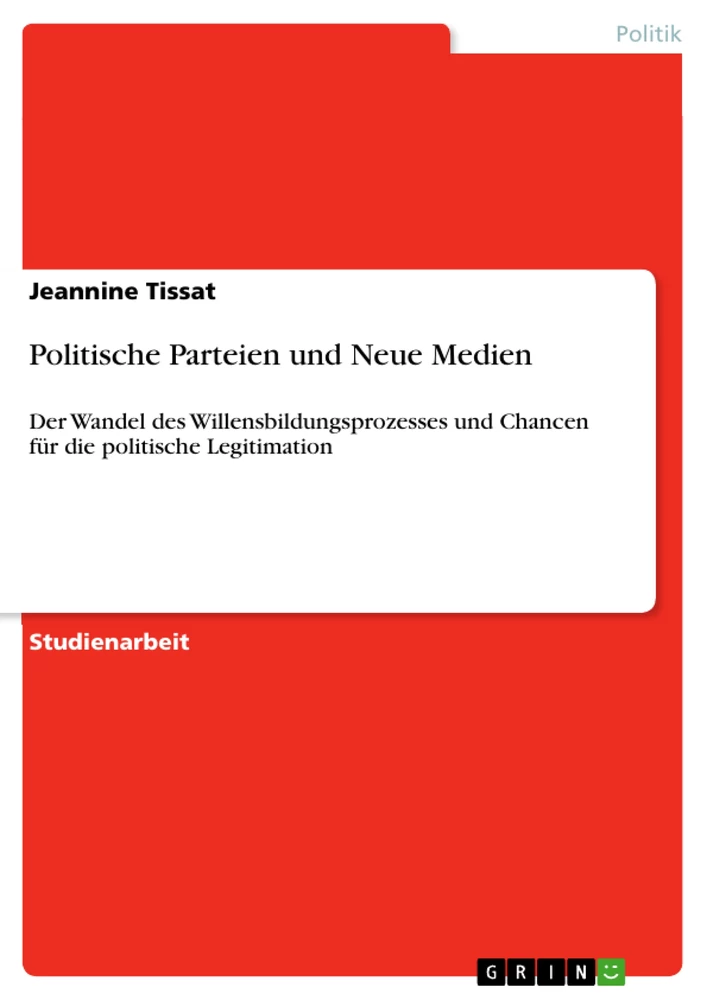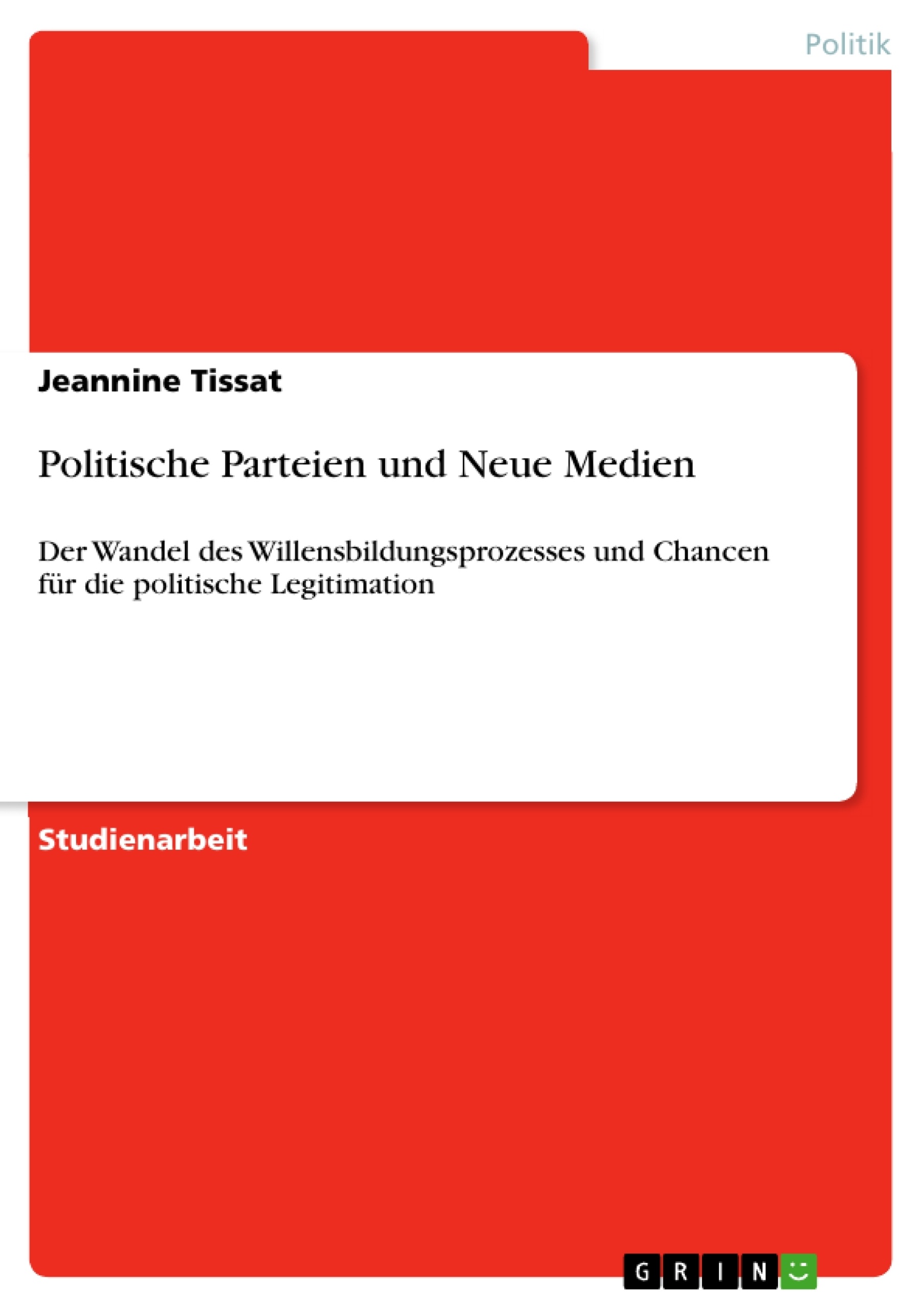Demokratie ist Kommunikation. Und seit jeher unterliegen Gesellschaft und Kommunikation, bedingt durch technische Entwicklungen und neuen Verbreitungsmöglichkeiten, Veränderungen. Besonders die Einführung der neuen Medien gegen Ende des 20. Jahrhunderts brachte eine Vielzahl neuer medialer Möglichkeiten mit sich. Die Drucktechnik wurde digitalisiert, das Kabel- und Satellitennetz ausgebaut, neue digitale Speichermedien, wie die CD-Rom, DVD, der USB-Stick und SD-Memory-Card, auf den Markt gebracht und nicht zuletzt wurde die Telefonie digitalisiert und somit das Internet im privaten Sektor nutzbar gemacht. Diese rasante Entwicklung neuer Kommunikationstechniken hat nicht nur Auswirkungen auf die Kommunikation im Allgemeinen sondern vor allem auf die politische Kommunikation im Besonderen. Unabhängig von verschiedenen Ausprägungen demokratischer Herrschaftsformen gilt für alle gleich, dass politische Legitimation durch Kommunikation erfolgt, also die Abhängigkeit der Zustimmung der Gesellschaft mit der Begründungspflicht der Politik einhergeht. Auf nationaler Ebene der Bundesrepublik Deutschland spielen besonders die Parteien eine entscheidende Rolle im Prozess der politischen Kommunikation und Willensbildung. Ihre Mitwirkung am Prozess der politischen Kommunikation und Willensbildung ist im Grundgesetz fest verankert (hierzu ausführlicher Kapitel 3.1.). Da jedoch die Politik in der Bundesrepublik Deutschland über keine eigenen Medien verfügt, sind auch die Parteien an die Nutzung der allgemein zugänglichen Massenmedien gebunden . Für die zu erbringende Vermittlungsleistung zwischen Staat und Bürgerschaft, der Einflussnahme auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung, zur Förderung der aktiven Teilnahme der Bürger am politischen Leben, zur Einflussnahme auf die politische Entwicklung im Parlament und auf die Regierung ist die Nutzung der zur Verfügung stehenden Massenmedien unabdingbar geworden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Problemstellung
1.1. Schwerpunkt der Untersuchung - Fragestellung
1.2. Beteiligungszentrierter und komplexer Demokratietheorieansatz
1.3. Methodische Vorgehensweise
2. Begriffliche Grundlegung
2.1. Neue Medien
2.2. Politische Kommunikation
3. Umgang und Nutzung neuer Medien im politischen Raum
3.1. Rechtliche Verortung
3.2. Politische Parteien ONLINE
3.2.1. Aufgabenfülle der politischen Parteien
3.2.2. Formelle und materielle Willensbildung
3.2.3. Institutionelle Willensbildung
3.3. Bundesregierung ONLINE
4. Politische Partizipation und neue Medien
5. Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis