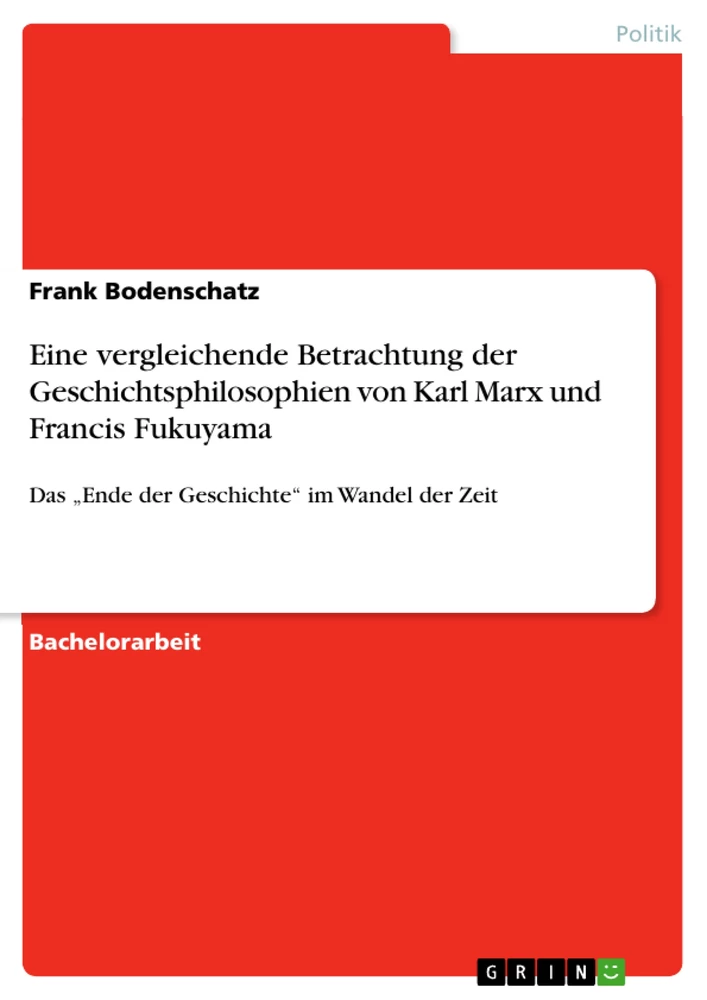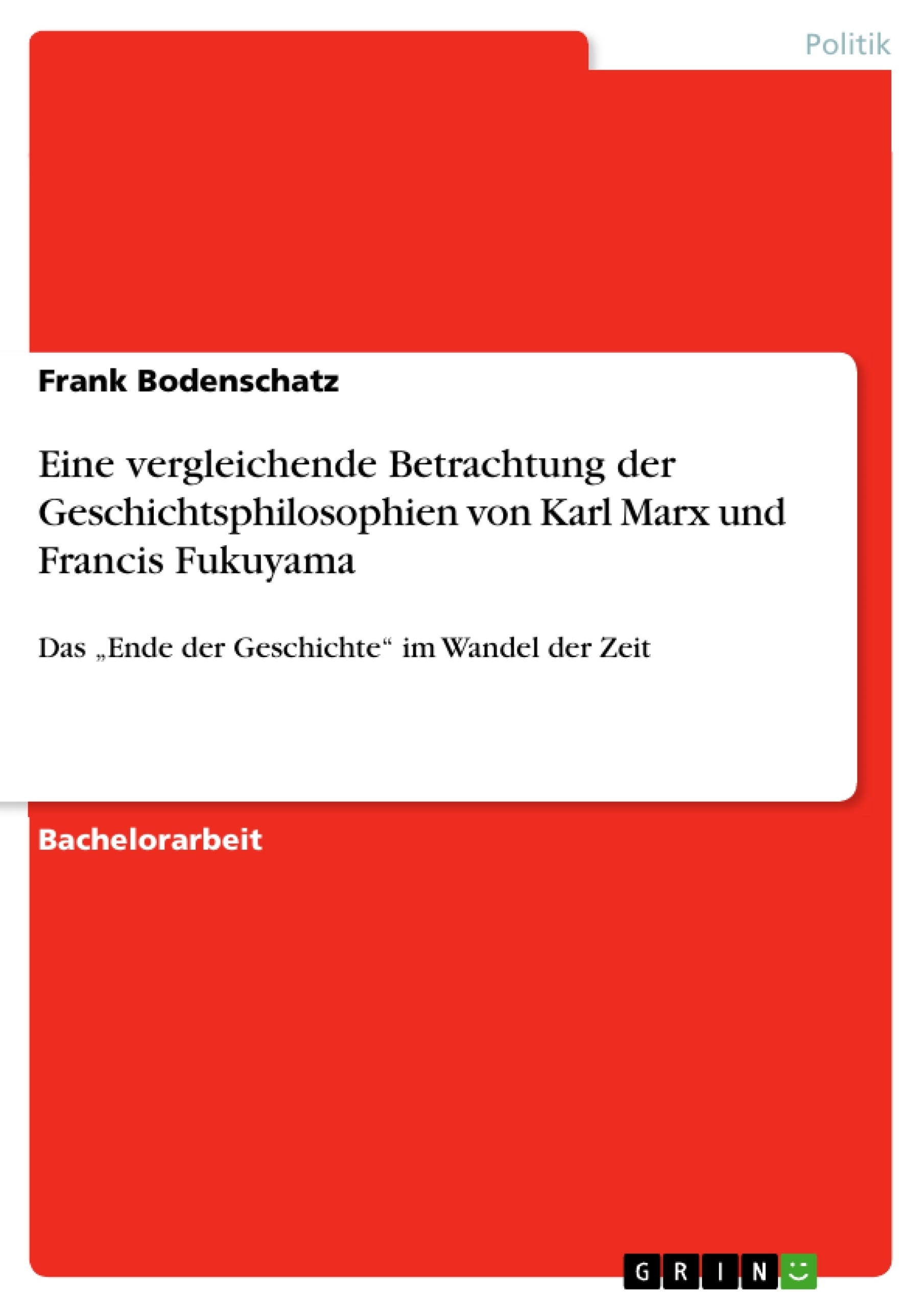Zwei Philosophen – zwei Enden der Geschichte. Der eine (Marx) gilt heute in dieser Angelegenheit – ironischerweise von der Geschichte selbst – als widerlegt, der andere (Fukuyama) wurde aufgrund seines naiv-optimistischen Fortschrittsglaubens vielfach belächelt und zu Unrecht unterschätzt. Betrachtet man beide allerdings im Zusammenhang mit dem jeweiligen historischen Kontext, so zeigt sich – unter Einbeziehung weiterer Denker, wie etwa Hegel und Kojève – ein höchst interessanter politisch-philosophischer Diskurs. Verschiedene Zeitepochen bringen ganz offensichtlich unterschiedliche Auffassungen vom Ende der Geschichte hervor bzw. beeinflussen sie maßgeblich. Diese Arbeit wagt im Rahmen einer vergleichenden Betrachtung den Versuch, sich vorurteilsfrei darauf einzulassen.
Auf welcher Grundlage prognostizierten Marx und Fukuyama jeweils das Ende der Geschichte, was sind die Voraussetzungen? Auf welche Weise wird das Ende der Geschichte erreicht, welche Entwicklungsschritte der Menschheit sind dafür notwendig? Inwiefern haben wir es mit teleologischen bzw. deterministischen Ansätzen zu tun? Wie sieht das Ende der Geschichte konkret aus und welche Rolle nimmt der Mensch in seiner letzten Bestimmung ein? Dies sind einige Fragen, an denen sich die vorzunehmende Untersuchung orientieren soll, um schließlich einen Vergleich der beiden Konzepte vorzunehmen. Die Untermauerung oder aber Widerlegung einer These („Marx und Fukuyama prophezeiten das Ende der Geschichte in Anbetracht der jeweiligen historischen Ausgangssituation unter umgekehrten Vorzeichen, bedienten sich aber derselben Methoden“) steht dabei im Zentrum der Analyse und bildet die konkrete Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau und Methodik
1.3 Forschungsstand
2 Karl Marx
2.1 Historischer Hintergrund / Ausgangslage
2.2 Geschichtsphilosophie: Historischer Materialismus
2.3 Das Ende der Geschichte als Weltkommunismus
2.4 Kritik
3 Francis Fukuyama
3.1 Historischer Hintergrund / Ausgangslage
3.2 Geschichtsphilosophie
3.3 Das Ende der Geschichte: Siegeszug der liberalen Demokratie
3.4 Kritik
4 Vergleich
4.1 Hegel-Rezeption
4.2 Universalismus, Teleologie und Determiniertheit
4.3 Ende der Geschichte?
4.4 Mögliche Gegenwartsbezüge
5 Schlussbetrachtung
5.1 Fazit
5.2 Ausblick
6 Bibliographie