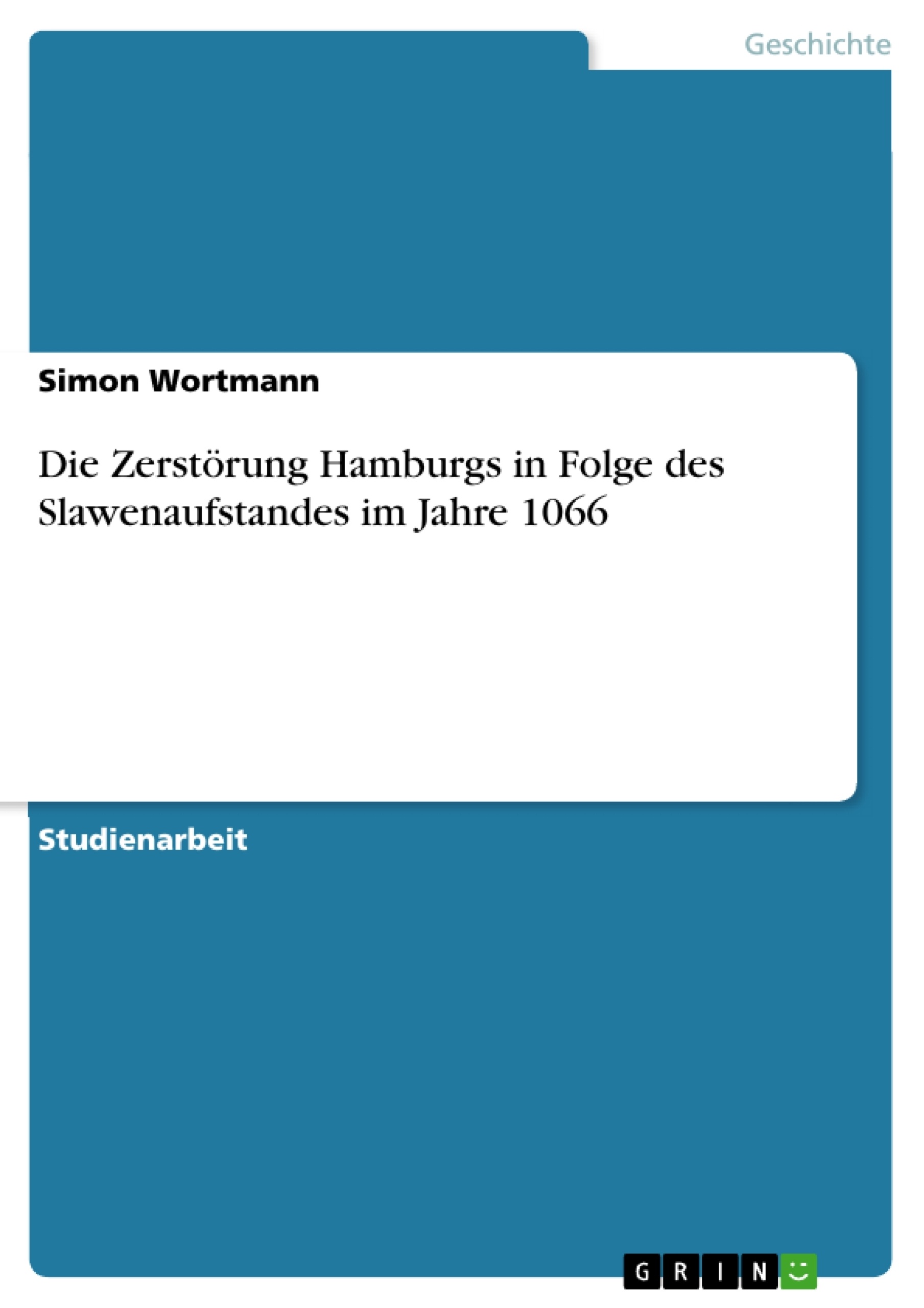Im Jahre 1066 wurde Hamburg in Folge eines Slawenaufstandes bis auf die Grundmauern zerstört. Es war nicht das erste Mal, dass der Stadt an der Elbe dieses Schicksal widerfuhr. Dieses Mal sollten aber fundamentale wirtschaftliche und kirchenpolitische Folgen daraus erwachsen. In dieser Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie es im Jahre 1066 zu der Zerstörung Hamburgs kam und welche Konsequenzen dies für das Erzbistum Hamburg-Bremen, die Stadt Hamburg und die Slawen im Norden des Reiches hatte. Im Vorwege der eigentlichen Analyse wird zunächst auf die Quellenlage eingegangen. Im Besonderen werden die Hauptquellen von Adam von Bremen und Helmold von Bosau vorgestellt und auf ihre Glaubwürdigkeit hin beurteilt. Dies umfasst auch einen inhaltlichen Exkurs zu den Lebensläufen der Chronisten.
Den Auftakt des Hauptteils bildet die Darstellung der politischen Lage im Reich vor dem verheerenden Aufbegehren der Slawen. Im Besonderen wird auf den Charakter und die kirchenpolitischen Ambitionen Erzbischof Adalberts von Hamburg-Bremen eingegangen. In diesen Zusammenhang fallen auch Erläuterungen zur Politik des jungen Kaisers Heinrich III. sowie zur politischen und wirtschaftlichen Situation der Slawen. Die in jenem Teil recht ausführlich vorgenommene Beschreibung der politischen Ausgangslage zwischen den Slawen, der Kirche, dem Kaiser und der Stadt Hamburg soll zum besseren Verständnis des Aufstandes beitragen.
Im zweiten Teil wird dargelegt, wie sich die politische Lage im Reich zuspitzte und letztendlich in dem Slawenaufstand und der Zerstörung Hamburgs gipfelte. Im Anschluss daran werden die Konsequenzen für den politischen Status der Slawen, die Missionspläne des Erzbistums Hamburg-Bremen und die politische und wirtschaftliche Lage Hamburgs anhand von ausgewählten Textstellen erläutert.
Die Zerstörung Hamburgs in Folge des Slawenaufstandes im Jahre 1066
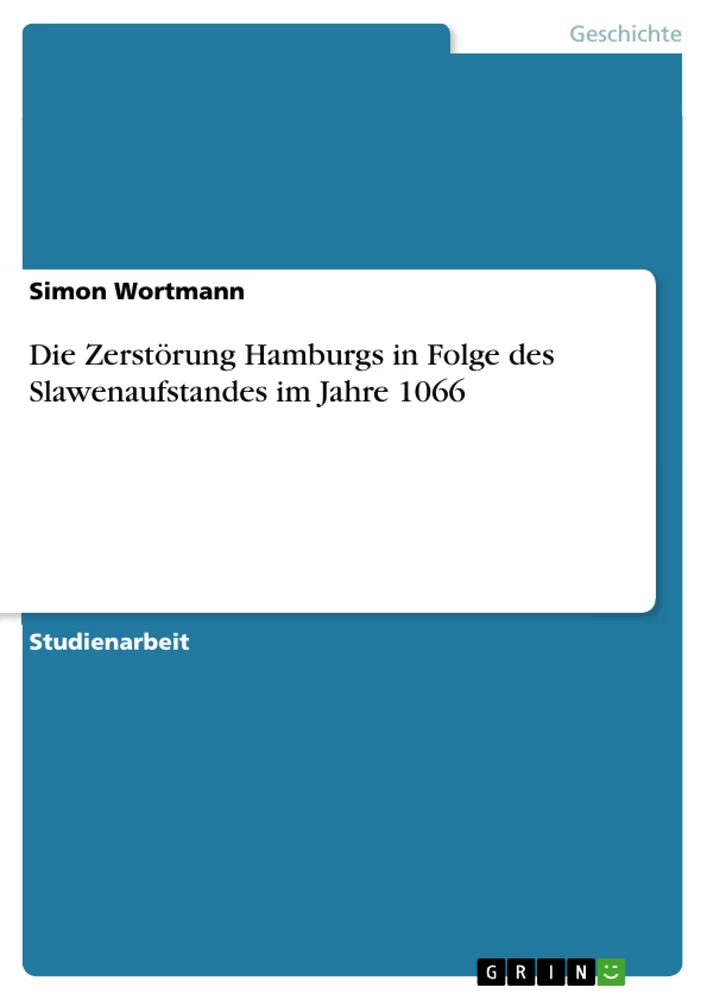
Hausarbeit , 2012 , 9 Seiten , Note: 2,3
Autor:in: Simon Wortmann (Autor:in)
Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit
Leseprobe & Details Blick ins Buch