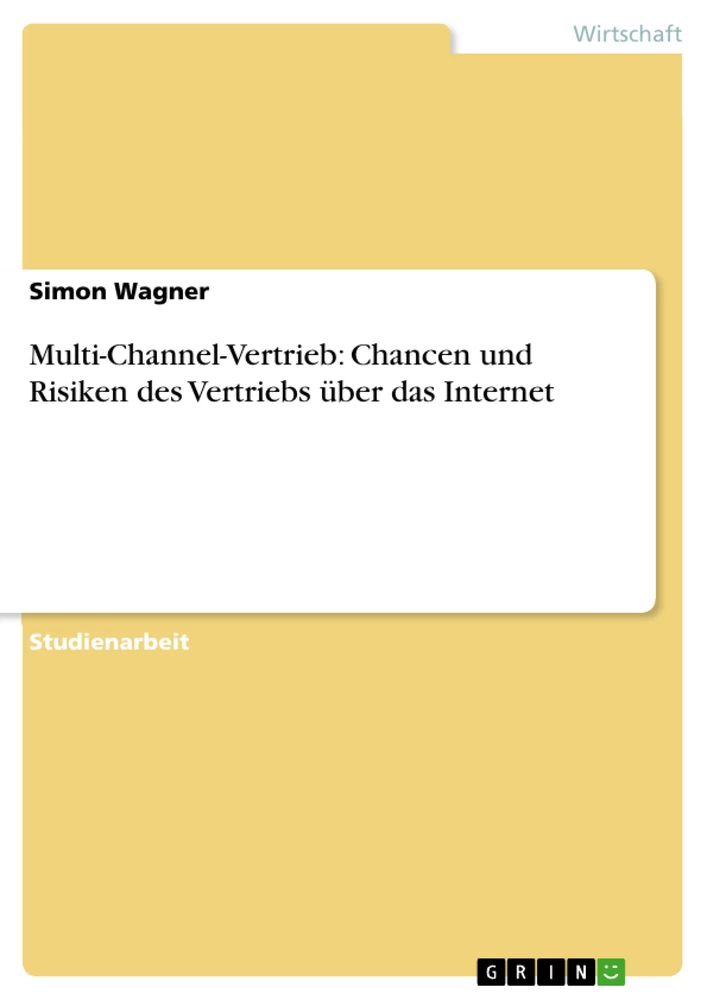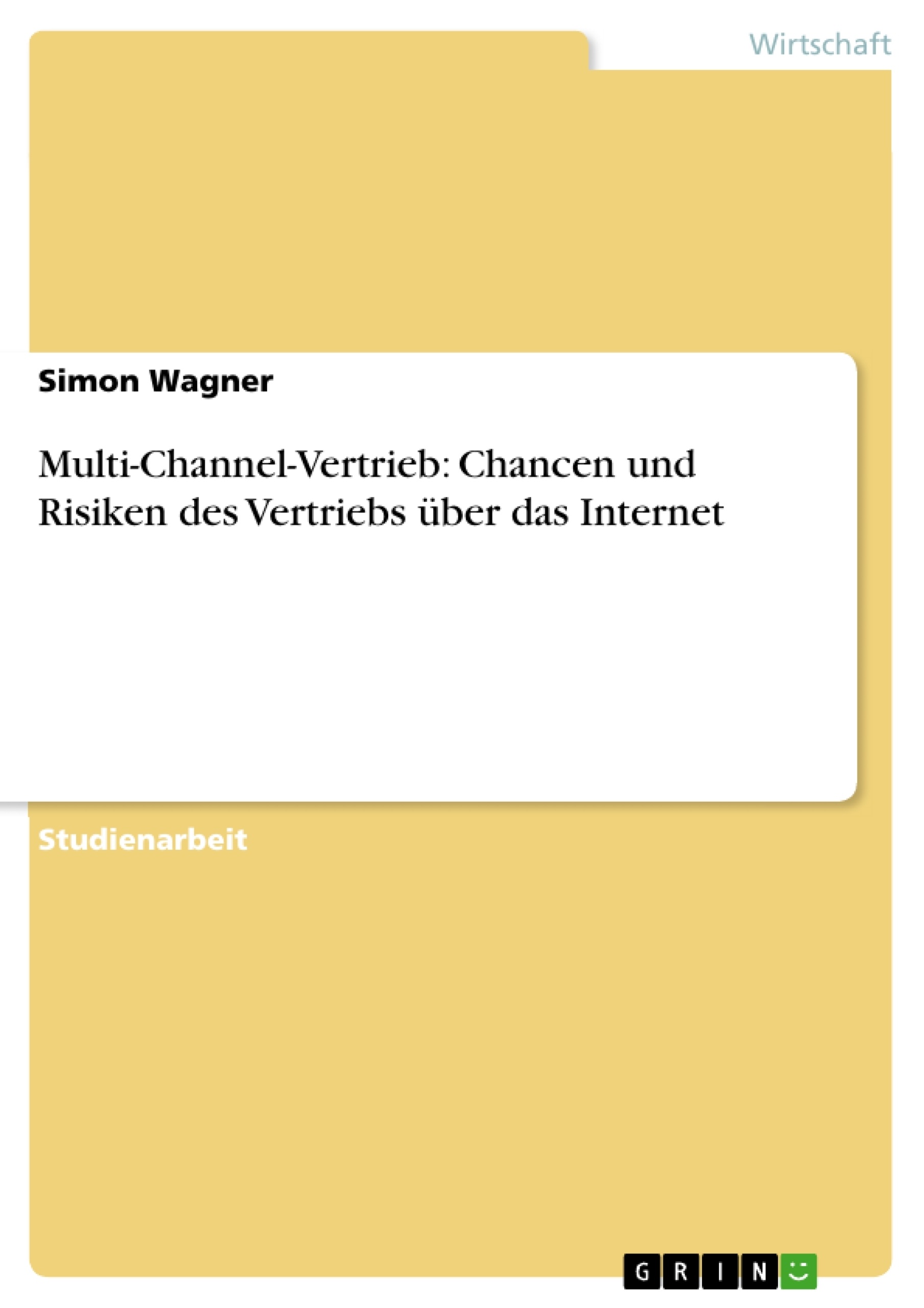Multi-Channel-Management bietet die Möglichkeit, Kunden über mehrere Vertriebskanäle anzusprechen. Diese Hausarbeit stellt das Konzept dar und geht insbesondere auf das Internet als zusätzlichen Vertriebskanal ein. Abschließend werden dann die Chancen und Risiken dieses Vorgehens bewertet.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
2. Grundlagen und Begriffe
2.1 Der Absatzkanal
2.2 Das Multi-Channel-Konzept
2.2.1 Vorgehensweise
2.2.2 Aktuelle Umfragezahlen
2.3 E-Commerce
2.3.1 Definition
2.3.2 Erscheinungsformen und Aufbau
3. Diskussion
3.1 Vor- und Nachteile des Multi-Channel-Vertriebs im Allgemeinen
3.1.1 Vorteile
3.1.2 Nachteile
3.2 Chancen und Risiken des Internet-Vertriebs im Speziellen
3.2.1 Chancen
3.2.2 Risiken
4. Fazit
4.1 Zusammenfassung und Ausblick
4.2 Kritische Betrachtung der Ergebnisse
Literaturverzeichnis