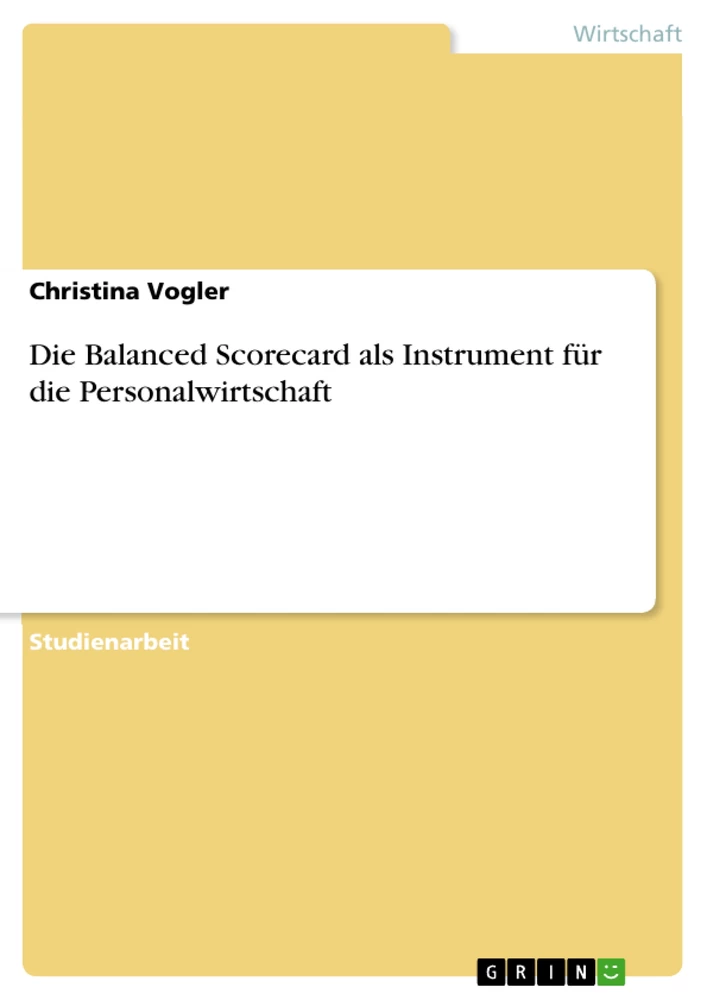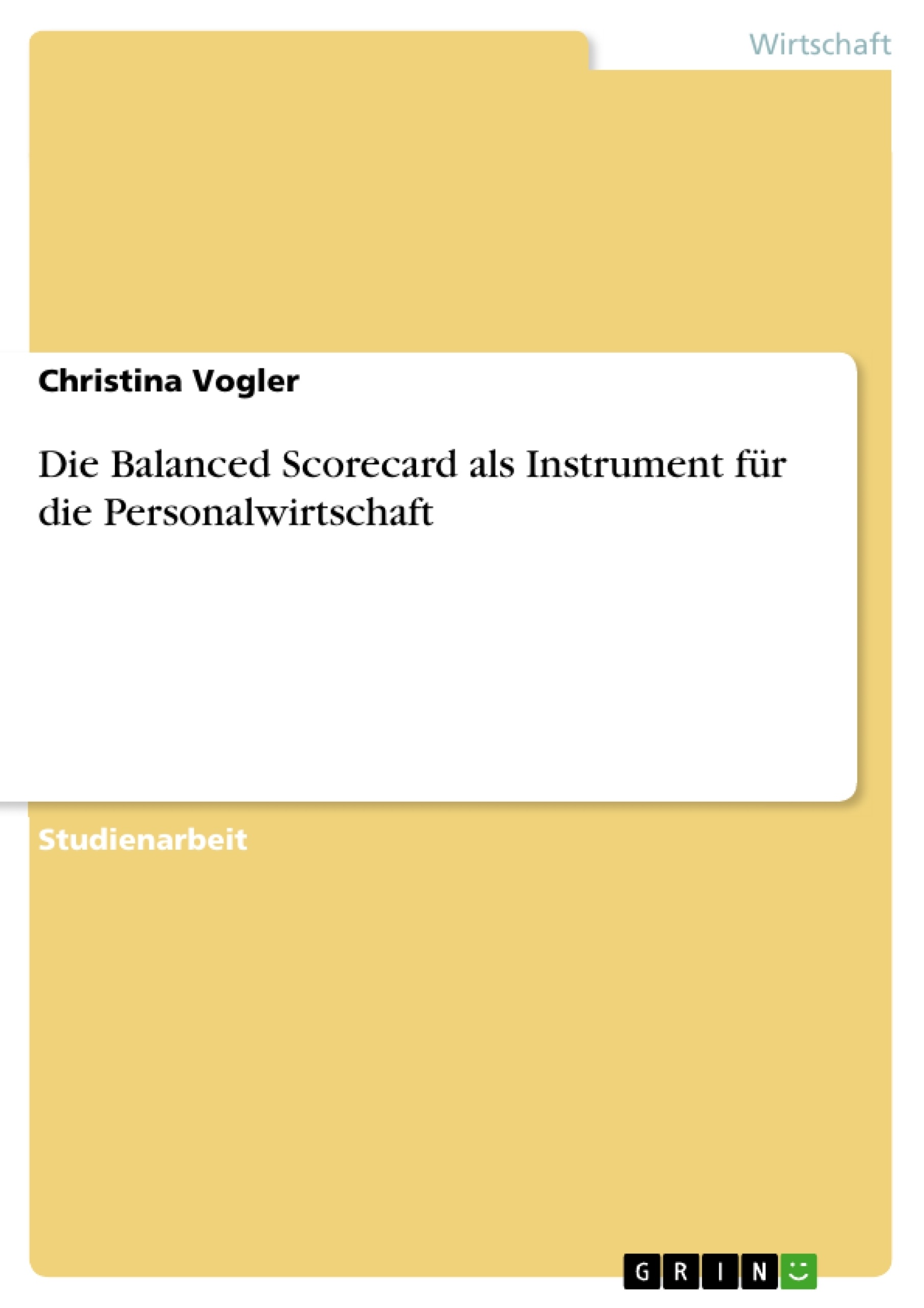Waren zu Beginn der 90er Jahre gerade einmal 12 US-amerikanische Firmen an dem Projekt von Kaplan und Norton beteiligt, wurde laut einer Studie der Katholischen Universität Eichstätt im November/ Dezember 2000 bereits bei 40% der Dax 100-Unternehmen die Balanced Scorecard erfolgreich eingesetzt. Knapp 10 Jahre später sind es gemäß der vierten Balanced Scorecard Studie von Horváth & Partners sogar schon 60% der DAX 100-Unternehmen. Thema dieser Seminararbeit ist ob und inwieweit sich die Balanced Scorecard als Instrument für die Personalwirtschaft eignet. Um diese Frage zu klären wird nach einer Einführung in das Konzept und die Erstellung einer Balanced Scorecard der Einsatz der Balanced Scorecard in der Personalwirtschaft geklärt. Die leitende Fragestellung lautet dabei, welche Rolle die Personalwirtschaft bei der Erstellung der Unternehmens-Scorecard spielt, und auch ob und wie eine eigene Balanced Scorecard für den Personalbereich erstellt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Balanced Scorecard
1.2 Personalwesen / Personalwirtschaft
2. Theorie der Balanced Scorecard
2.1 Hintergründe und Entwicklung der Balanced Scorecard
2.2 Das Konzept der Balanced Scorecard
2.2.1 Ziel der Balanced Scorecard
2.2.2 Entwicklung einer Balanced Scorecard
2.2.3 Die vier Perspektiven nach Norton und Kaplan
3. Einsatz der Balanced Scorecard in der Personalwirtschaft
3.1 Balanced Scorecard aus Sicht der Personalwirtschaft
3.2 Konzept einer Balanced Scorecard für das Personalmanagement
3.2.1 BSC-Eignung von Personalabteilungen
3.2.2 Übertragung des BSC-Konzepts auf das Personalmanagement
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang