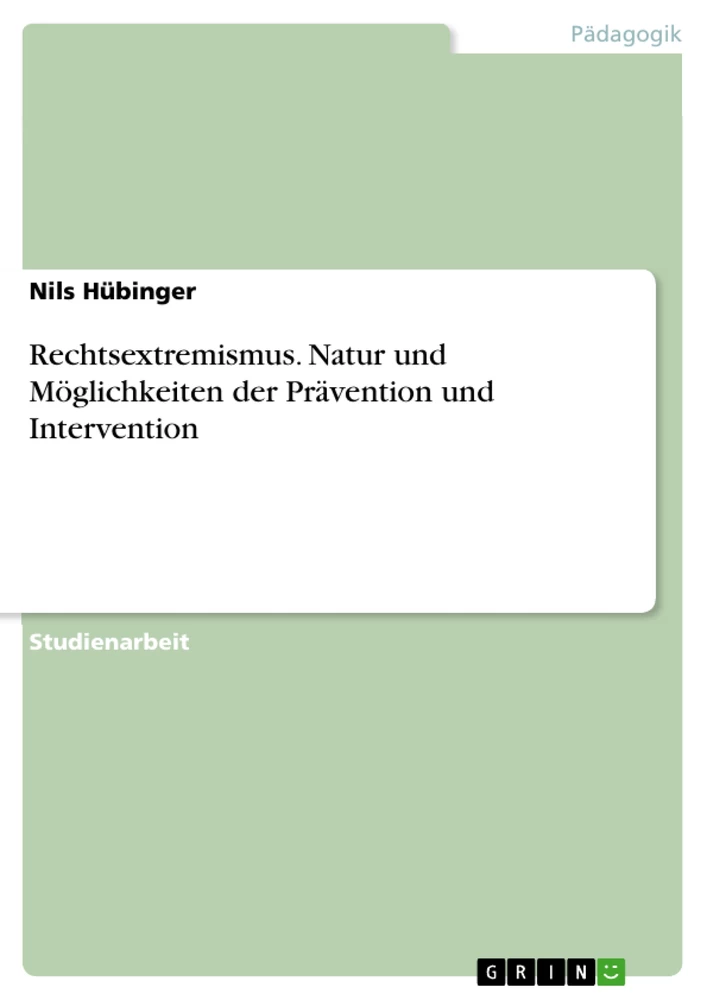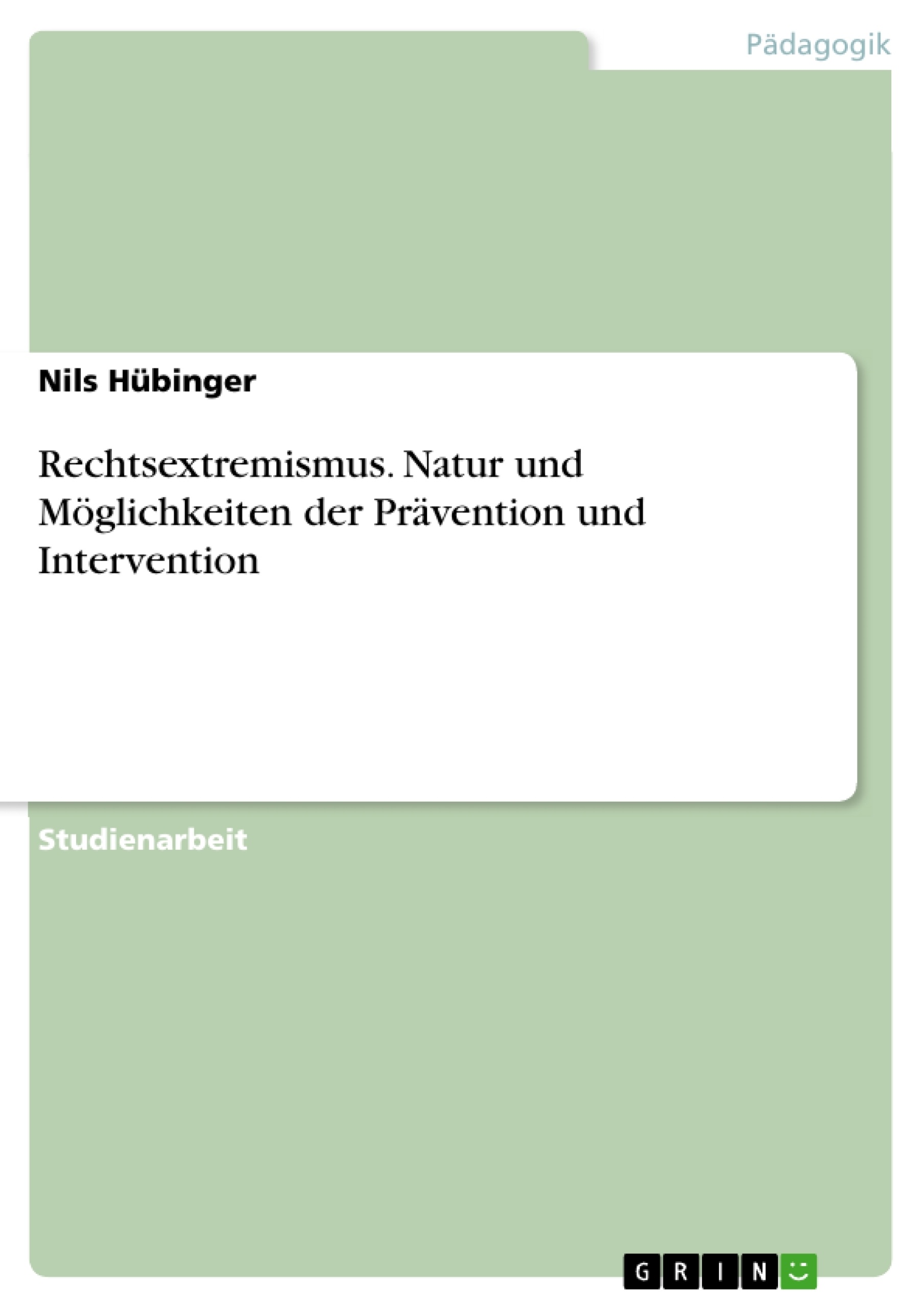Spätestens seit Veröffentlichung der Sinus-Studie im Jahr 1981 offenbarte sich, dass eine rechtsextremistische Orientierung unter jungen Menschen in Deutschland an Popularität gewann. Diese Entwicklung gipfelte erstmals in den ausländerfeindlichen Ausschreitungen von Hoyerswerda in den neuen Bundesländern 1991. Ein Jahr später schwappte die Welle auch nach Westdeutschland über und führte zu massiven Ausschreitungen in Rostock- Lichtenhagen. Die Zuspitzung der Lage führte dazu, dass bis dato bereits existierende pädagogische Projekte mit rechtsorientierten Jugendlichen weiter ausgebaut und gefördert wurden. Öffentlichen Anklang erfuhr die pädagogische Arbeit in Zusammenhang mit rechtsorientierten Jugendlichen jedoch erst nach den Ausschreitungen, nachdem das Ausmaß an Gewaltbereitschaft zu einem Aufschrei in der Gesellschaft geführt hatte.
Es stellt sich die nun Frage, auf welcher Grundlage sich Rechtsextremismus entwickeln kann? Die Klärung der Ursachen ist entscheidend, um die Ansatzpunkte der pädagogischen Jugendarbeit und politischen Bildung im Umgang mit rechtsorientierten jungen Menschen nachvollziehen zu können, denn die Betroffenen werden sich nur von ihren Ansichten entfernen, wenn sie eine bessere Alternative in Aussicht gestellt bekommen. Um einen Zugang zu den betroffenen Jugendlichen zu erhalten, wird das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit seit einigen Jahren zugrunde gelegt. Das Augenmerk der akzeptierenden Jugendarbeit liegt auf gegenseitiger Akzeptanz und dem verständnisvollen Umgang zwischen Pädagogen und rechtsorientierten Jugendlichen. Das Tätigkeitsfeld der Jugendarbeit ist von großer Bedeutung für die Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus. Auch in der außerschulischen und schulischen politischen Bildung existiert ein facettenreiches Angebot, aus welchem im weiteren Verlauf einige Elemente aufgegriffen und vorgestellt werden. Hier gibt es einige Interessante Programme und Möglichkeiten, die Chancen aufzeigen, rechtsorientierte Jugendliche zu Toleranz, Empathie und demokratischem Handeln zu befähigen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Worin liegen die Ursachen für Rechtsextremismus?
3. Präventions- & Interventionsmaßnahmen gegen Rechtsextremismus
3.1 Ansätze der pädagogischen Jugendarbeit und Vorbeugung in der Kindheit
3.2 Möglichkeiten und Grenzen der politischen Bildung
4. Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis