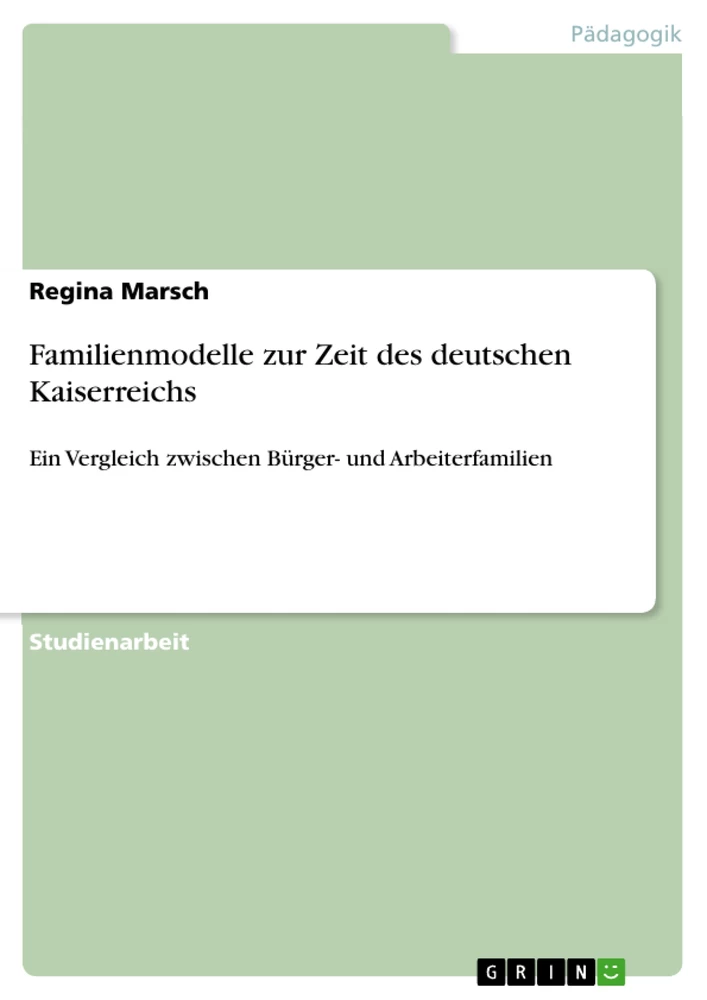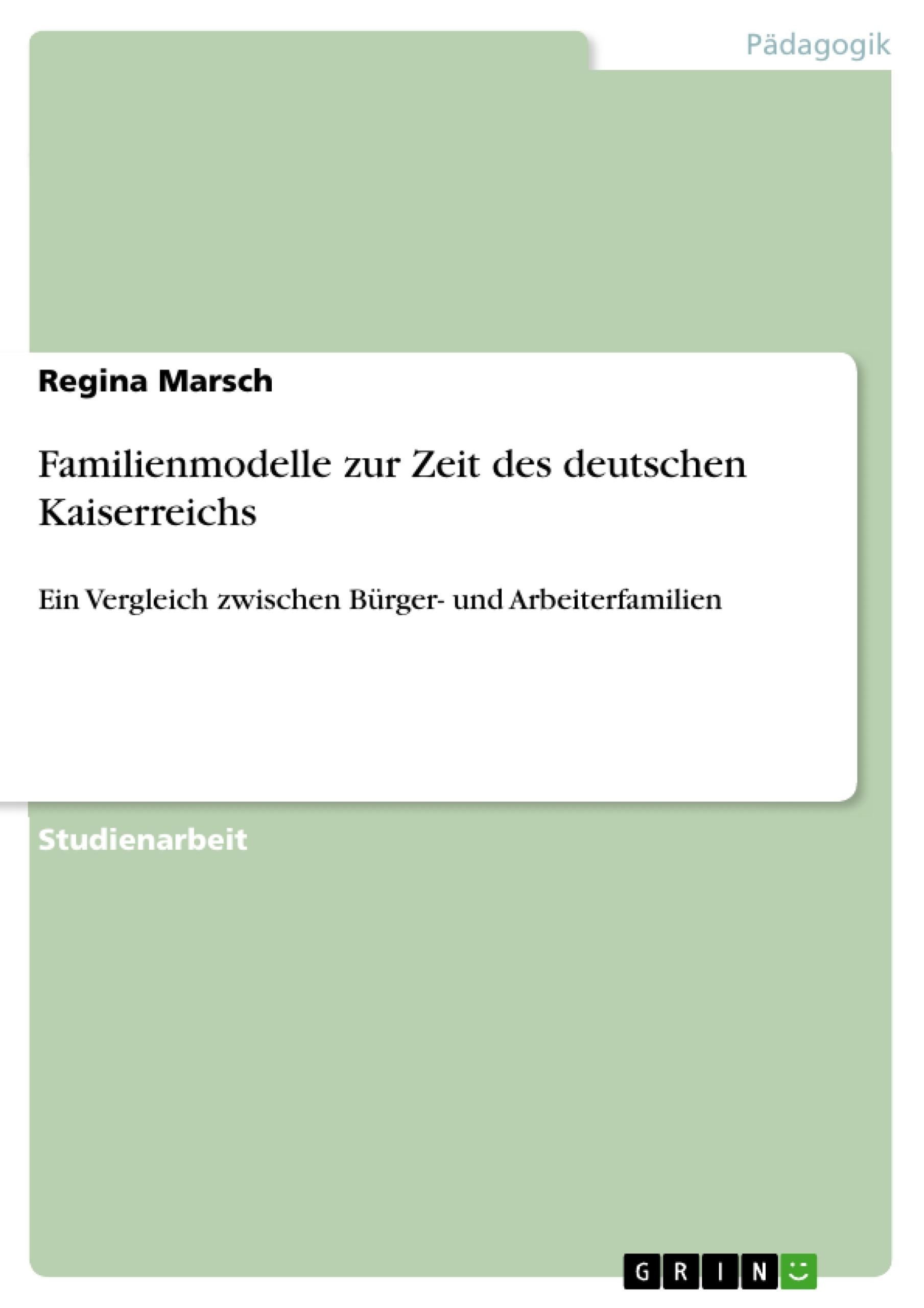[...] In der hier vorliegenden Arbeit möchte ich einen Vergleich zwischen der Kindheit in der
Arbeiterklasse und der Kindheit in bürgerlichen Familien zur Zeit des deutschen Kaiserreiches
anstellen. Zur Verbesserung der Anschaulichkeit werde ich mich, neben den wissenschaftlichen
Texten, auf ausgewählte Biographien beziehen, die die damaligen Umstände
aus der Sicht der Kinder beschreiben. Dabei werde ich auch auf einige Klischeevorstellungen,
welche sich bei oberflächlicher Befassung mit dem Thema bilden können, eingehen,
etwa dass das Leben der Arbeiterkinder den eigenen Eltern nicht besonders wichtig war
und sie über die hohe Kindersterblichkeit der damaligen Zeit eher froh waren, oder der,
dass Bürgerkinder generell verhätschelt wurden.
Zunächst befasse ich mich mit der Arbeiterfamilie. Neben einer kurzen Beschreibung der
typischen Rollen und Verhaltensweisen der Mutter und des Vaters, erhält das Leben und
die Behandlung des Kindes die Hauptrolle in dieser Arbeit. Hier werde ich näher auf die Lebensumstände, das Verhältnis zu den Eltern, die allgemeine Erziehung, Bildung und
Entwicklung und zuletzt auf die Strafen eingehen, die ein Kind typischerweise zu dieser
Zeit in seiner jeweiligen Klasse zu erwarten hatte. Diesem stelle ich dann die typische
Kindheit in den bürgerlichen Familien gegenüber, mit der gleichen Aufteilung der jeweils
behandelten Thematik. Zusammenfassend werde ich die wichtigsten Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der jeweiligen Kindheitsmodelle noch einmal Gegenüberstellen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Arbeiterfamilie
2.1 Familienkonstellationen
2.1.1 Die Rolle der Mutter
2.1.2 Die Rolle des Vaters
2.2 Die Kindheit in der Arbeiterfamilie
2.2.1 Lebensumstände des Kindes
2.2.2 Verhältnis zu den Eltern
2.2.3 Erziehung, Bildung und Entwicklung
2.2.4 Strafen
3. Die Bürgerfamilie
3.1 Familienkonstellationen
3.1.1 Rolle der Mutter
3.1.2 Rolle des Vaters
3.2.1 Die Lebensumstände des Kindes
3.2.2 Verhältnis zu den Eltern
3.2.3 Erziehung, Bildung und Entwicklung
3.2.4 Strafen
4. Zusammenfassung
5. Literaturverzeichnis