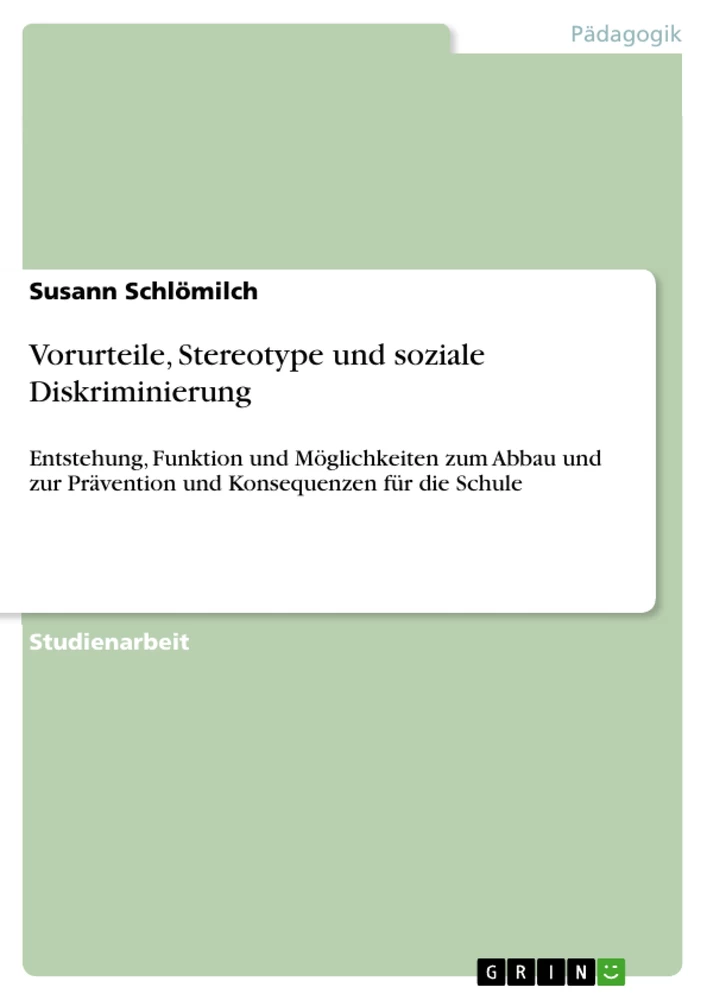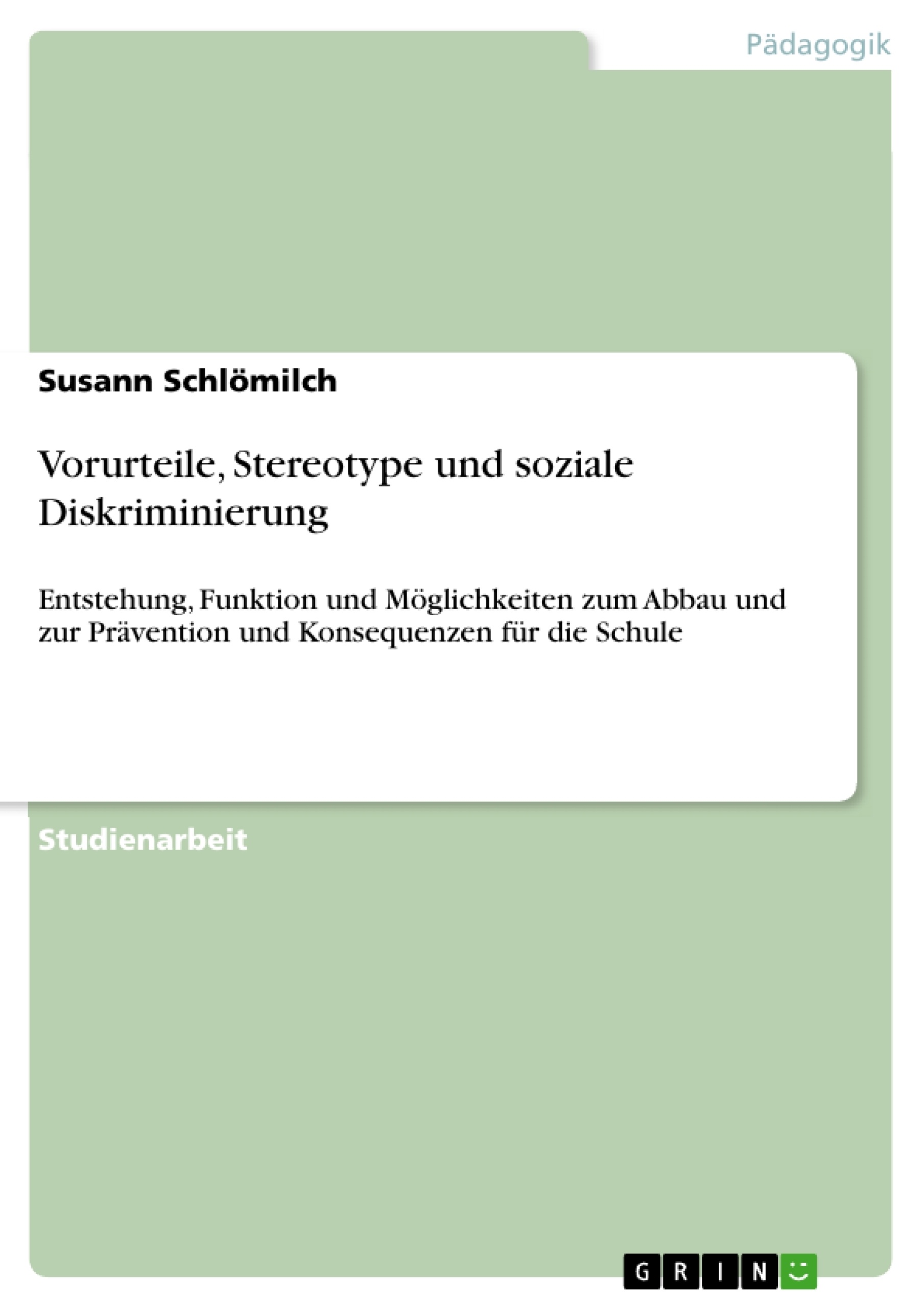Vorurteile spielen - bewusst oder unbewusst - in unserem täglichen Leben, insbesondere in der zwischenmenschlichen Interaktion eine große Rolle. Wie im aufgeführten Zitat angedeutet wird, scheint sich die Bedeutung des Vorurteils allein auf eine ausschließlich negative zu beschränken. Inwiefern dies gerechtfertigt ist, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. So beschäftigt sich diese Darstellung mit den verschiedenen Formen der sozialen Einstellungen: dem Vorurteil, dem Stereotyp und der sozialen Diskriminierung. Anhand verschiedener Theorien soll der Frage ihrer Entstehung und ihrer Änderungsresistenz nachgegangen werden aber auch der ihrer verschiedenen Funktionen.
Das Wissen um diese Phänomene menschlichen Zusammenlebens ist auch für den schulischen Kontext von großer Bedeutung. So führen Vorurteile nicht selten zu Konflikten zwischen und zu Mobbing von Schülerinnen und Schülern. Doch dürfen Lehrkräfte nicht vergessen, dass sie auch selbst in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer SuS nicht frei von Vorurteilen sind. Daher ist es wichtig, das eigene Verhalten in dieser Hinsicht kritisch zu reflektieren. Ferner ist es notwendig, verschiedene Möglichkeiten des Intervenierens zu kennen. Daher sollen in dieser Arbeit verschiedene allgemeine Ansätze zum Abbau und zur Prävention von Vorurteilen und Stereotypen vorgestellt und diese in einem zweiten Schritt auf den schulischen Kontext angewendet werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Soziale Einstellungen und ihre Funktionen - ein Überblick
2.1. Das Vorurteil
2.2. Das Stereotyp
2.2.1. Funktionen von Vorurteilen und Stereotypen
2.2.2. Fehlerhafte Urteilsprozesse bei Vorurteilen und Stereotypen
2.3. Die Soziale Diskriminierung
2.3.1. Funktionen der sozialen Diskriminierung
3. Ansätze zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen
3.1. Die Theorie der autoritären Persönlichkeit nach Adorno
3.2. Die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts nach Sherif
3.3. Die Theorie der sozialen Identität nach Tajfel
4. Prävention und Abbau von Vorurteilen
4.1. Die Kontakthypothese
4.2. Die Hypothese der Informations- und Wissensvermittlung
4.3. Konsequenzen für Schule und Unterricht
4.3.1. Die Realisierung der Kontakthypothese im schulischen Kontext
4.3.2. Die Vermittlung von Information und Wissen im schulischen Kontext
Bibliografie