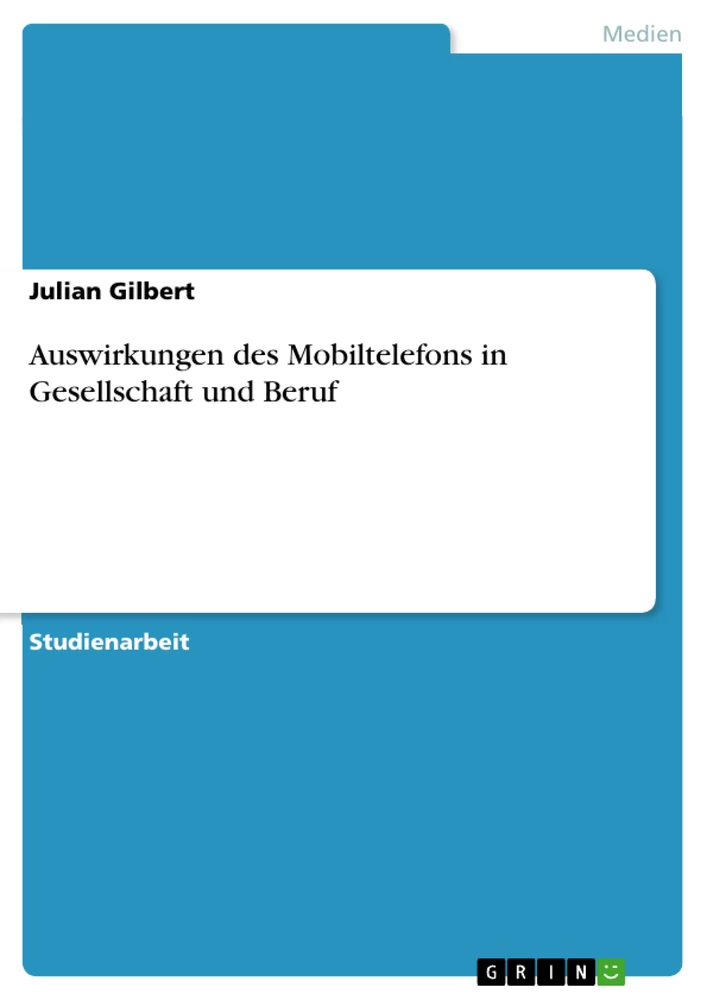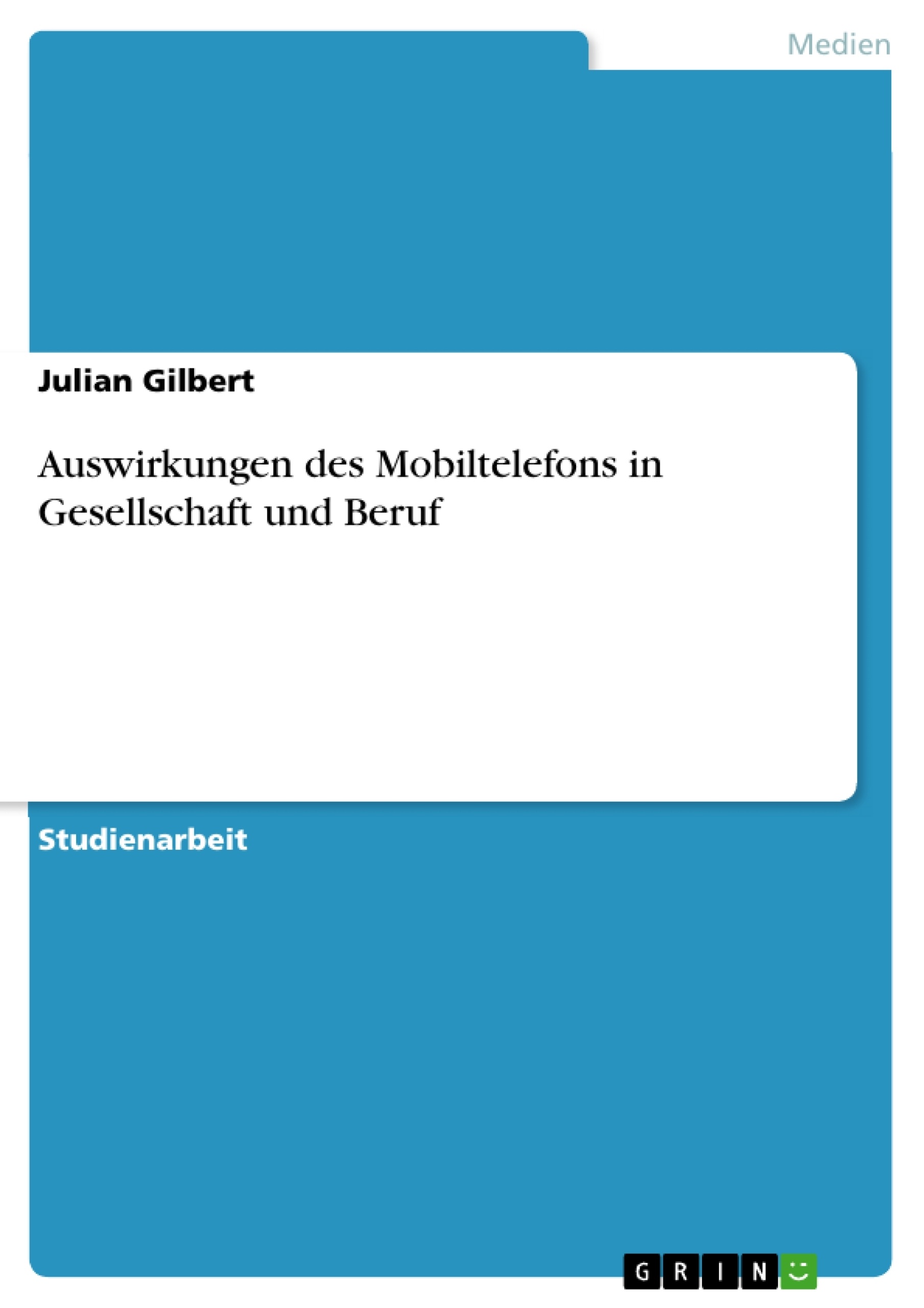Eine Gesellschaft ohne das Handy ist heutzutage kaum mehr vorstellbar. Für einen Großteil der Bevölkerung industrieller Nationen ist das Handy mittlerweile ein fester Bestandteil der täglichen Nutzgegenstände geworden, auf das häufig weder verzichtet werden kann noch will.1 Die Überwindung von räumlicher Distanz, unabhängig von der jeweiligen örtlichen Position von zwei Kommunikationspartnern, ist dabei das elementare Merkmal des Handys. Mit dem Aufkommen dieser Technologie kommt es zu einer neuen Bestimmung von altbewährten Begrifflichkeiten wie Verfügbarkeit oder Mobilität, die bereits mit der Entstehung des Telefons neu definiert werden mussten. Darüber hinaus eröffnen sich durch den andauernden Technologiefortschritt sowie der Entwicklung neuer Implikationen speziell für Mobiltelefone neue Möglichkeiten für die Handybesitzer. Diese können allerdings nicht nur das eigene Nutzungsverhalten beeinflussen, sondern ebenso den Alltag von Mitmenschen verändern, welche die Technologien überhaupt nicht nutzen bzw. nutzen wollen. Als letzte Konsequenz dieser Verkettung können neuartigen Entwicklungen des Mobiltelefons somit auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene relevant werden, insbesondere dann, wenn die Partizipation an einer bestimmten Implikation als notwendig erscheint.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll auf diese Veränderungsprozesse in der Gesellschaft eingegangen werden, indem sowohl Fragestellungen der positiven wie auch negativen Beeinflussung, die mit dem Aufkommen der Technologie hervortraten und weiterhin stetig hinzukommen, untersucht werden. Kann das Handy als revolutionäre Entwicklung angesehen werden, die den Menschen das Leben in allen Bereichen erleichtert? Oder stellt es für viele Bürger eine zusätzliche Belastung dar, derer sie sich aussetzen müssen, um mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten zu können? Und welche Potentiale und Möglichkeiten, aber auch Gefahren und Risiken bringt die Entwicklung des Mobiltelefons für das gesellschaftliche Miteinander hervor? Im Folgenden wird es nun darum gehen, Antworten auf diese Fragestellungen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Mediengeschichte des Handys
3 Das Mobiltelefon in der Gesellschaft
3.1 Mobilität und Erreichbarkeit
3.2 Neubestimmung von Privatheit und Öffentlichkeit durch Mobilkommunikation
3.3 Der Wert von Kommunikation im mobilen Zeitalter
3.4 Zunahme der Kontrollgesellschaft durch das Handy?
4 Das Handy im Beruflichen Umfeld
4.1 Stressfaktor Handy?
4.2 Das Handy als Marketinginstrument für Unternehmen
5 Alleskönner Handy
5.1 Das Handy als Multimedia Tool
5.2 Mobiles Internet und Applications: Die Geburt des Smartphones
6 Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Publikationen
Online-Quellen
Anhang