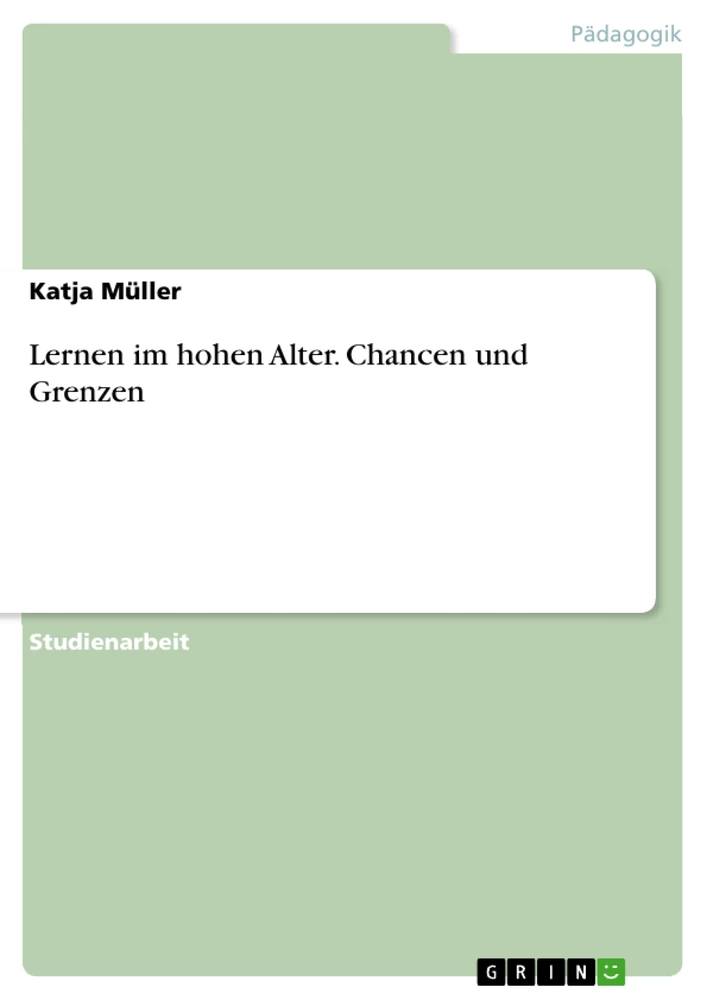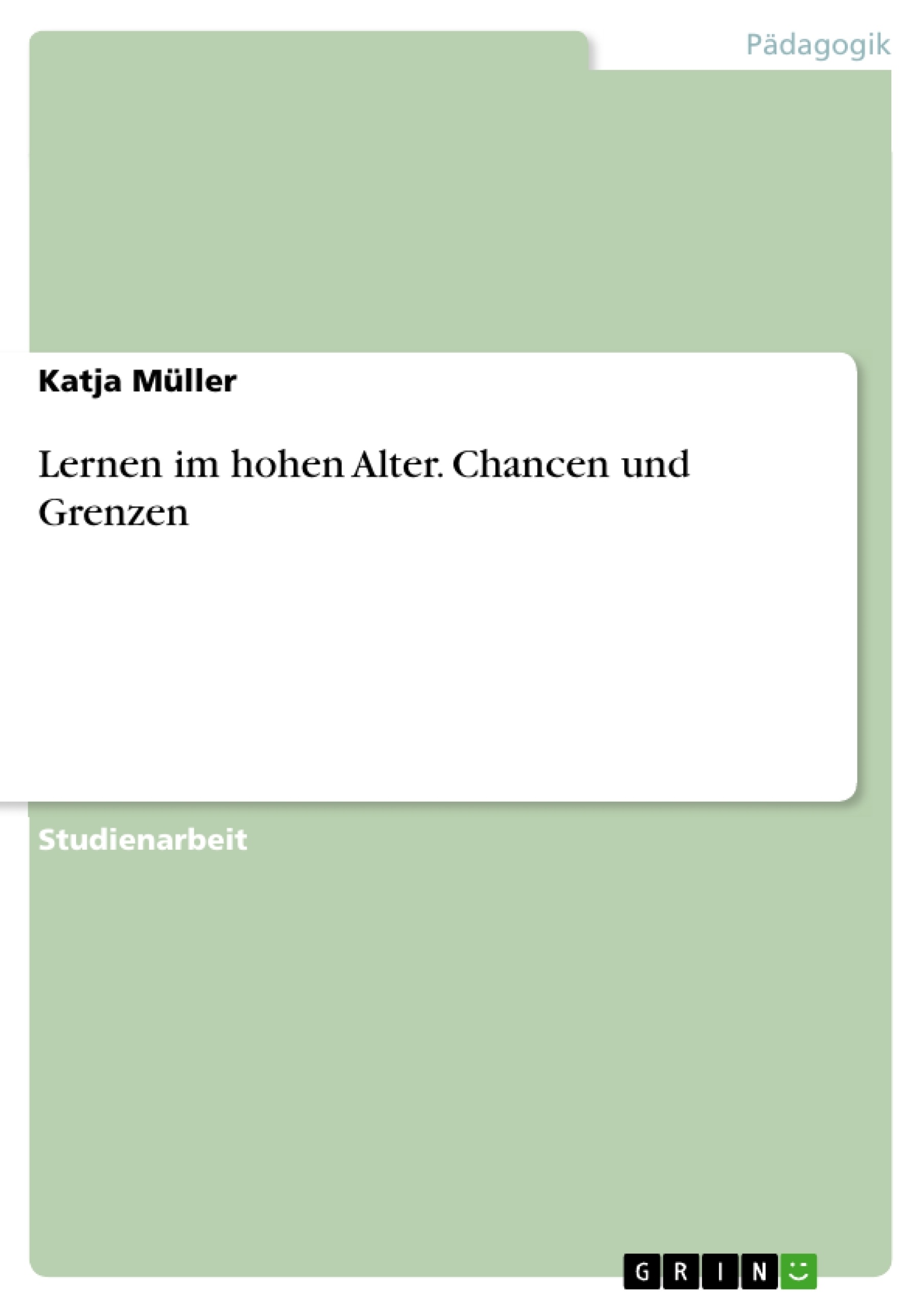„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.“ (Benjamin Britten)
Begriffe wie „Lebenslanges Lernen“ oder Seminartitel und –konzepte wie „Der Mensch lernt niemals aus“ gewinnen auf allen politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Ebenen immer mehr an Bedeutung. Aufgrund demografischer Entwicklungen rücken auch immer mehr Erwachsene in der nachberuflichen Phase in den Fokus von Politik und Wissenschaft.
Begriffe wie die „neuen Alten“ oder die „jungen Alten“ zeigen auf, dass die Lebensphase Alter neu gedacht und interpretiert wird. Alter zeichnet sich heute in der allgemeinen Wahrnehmung (auch aufgrund medialer Darstellungen) eher durch Produktivität und Aktivität, als durch Schwäche, Krankheit und Verluste aus. Der allgemeine Kanon lautet vielmehr: Alles ist möglich. Gestützt wird diese These auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel aus der Gehirnforschung, die mit der Entdeckung der Neuroplastizität festgestellt hat, dass ein Gehirn eines Älteren ähnlich leistungsfähig sein kann, wie das eines jungen Menschen.
Doch was passiert, wenn der Mensch physisch und psychisch an seine Grenzen stößt? Wenn er aufgrund seines Alters und der nachlassenden Kraft nicht mehr dem Bild der „jungen Alten“ mit offensichtlichem Entwicklungspotential entspricht?
Welche Entwicklungsmöglichkeiten hat der Mensch im hohen Lebensalter, indem er zunehmend mehr in verschiedene Formen der Abhängigkeit geraten kann?
Hilft ihm ein lernendes Auseinandersetzen mit sich und seiner Umwelt vor einem zurücktreiben im Lebensstrom? Was muss im Lehr-Lern-Prozess beachtet werden, dass „Hochaltrige“ für sich, im Sinne einer Ermöglichungsdidaktik, einen viablen (Lern-)Weg finden?
Wo liegen beim Lernen in der Hochaltrigkeit die Chancen und wo die Grenzen?
Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung erfolgt in dieser Hausarbeit. Es wird beschrieben, auf welcher Basis ein Lernen im hohen Alter möglich ist und auf welcher didaktischen Grundlage Lehr-Lernprozesse gestaltet werden müssen, damit diese erfolgreich umgesetzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung – Problembeschreibung und Gang der Arbeit
2. Thematische Hinführung und Definitionen
2.1. Demographischer Wandel und alternde Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland
2.2 Alter
3. Lebenslanges Lernen
3.1 Lerndimensionen und Lernformen
3.2 Lernen und Bildung
3.3 Lernen, Gehirn und Motivation – physiologische Voraussetzungen für ein Lernen bis in die Hochaltrigkeit
4. Lernen in der Hochaltrigkeit – Lernen im vierten Lebensalter
4.1 Kompetenz und Performanz
4.2 Kompetenz und Performanz in der Hochaltrigkeit in Abhängigkeit zur individuellen Bedürfnisbefriedigung
5. Ermöglichungsdidaktik und Hochaltrigkeit
6. Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
Anhang I
Anhang II