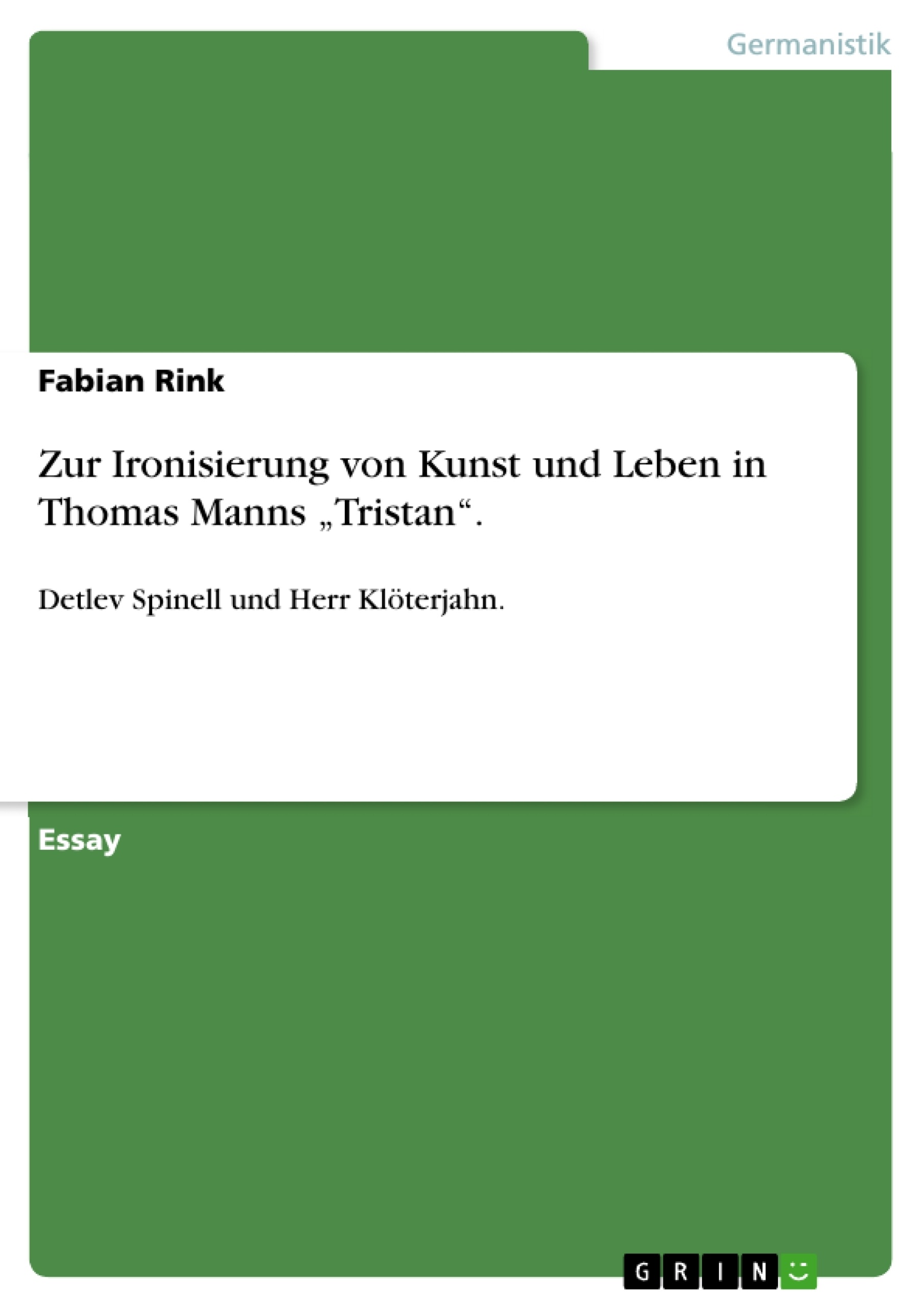Der Erzähler in Thomas Manns Novelle Tristan gibt nicht nur den Décadent Spinell sondern auch seinen vitalen Gegenspieler Klöterjahn vielfach der Lächerlichkeit preis. Welche Auswirkungen dies für das Verhältnis des Lesers zu den Figuren bzw. den von ihnen repräsentierten Positionen hat, und was Mann mit dieser Erzählstrategie bezwecken will versucht der vorliegende Essay zu erörtern.
Zur Ironisierung von Kunst und Leben in Thomas Manns „Tristan“.
Detlev Spinell und Herr Klöterjahn.
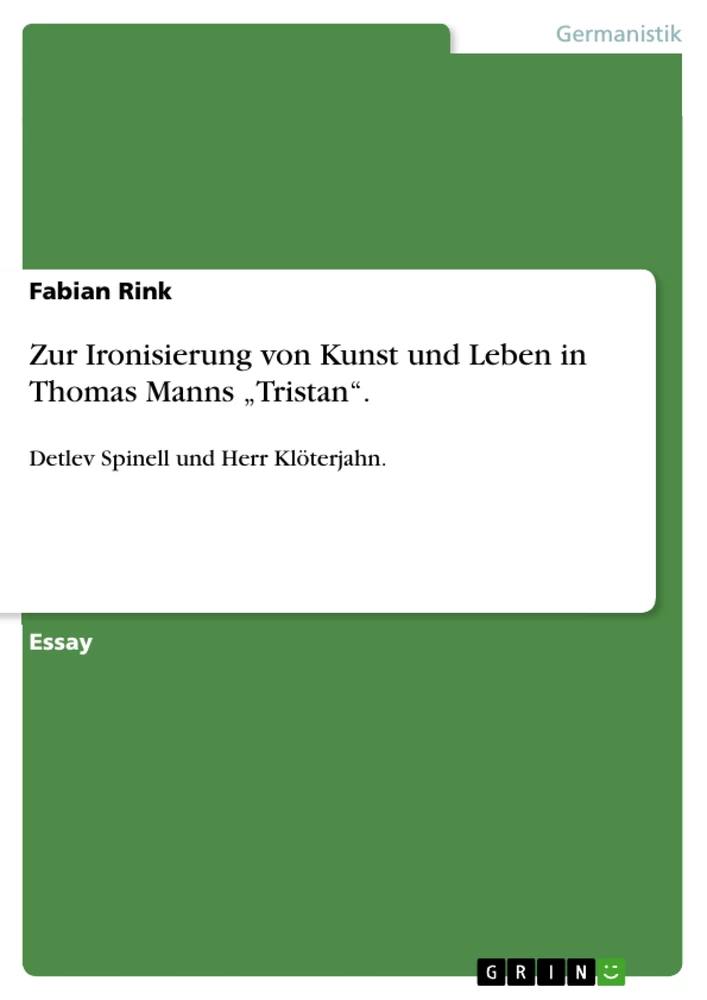
Essay , 2012 , 5 Seiten , Note: 2,0
Autor:in: Fabian Rink (Autor:in)
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur
Leseprobe & Details Blick ins Buch