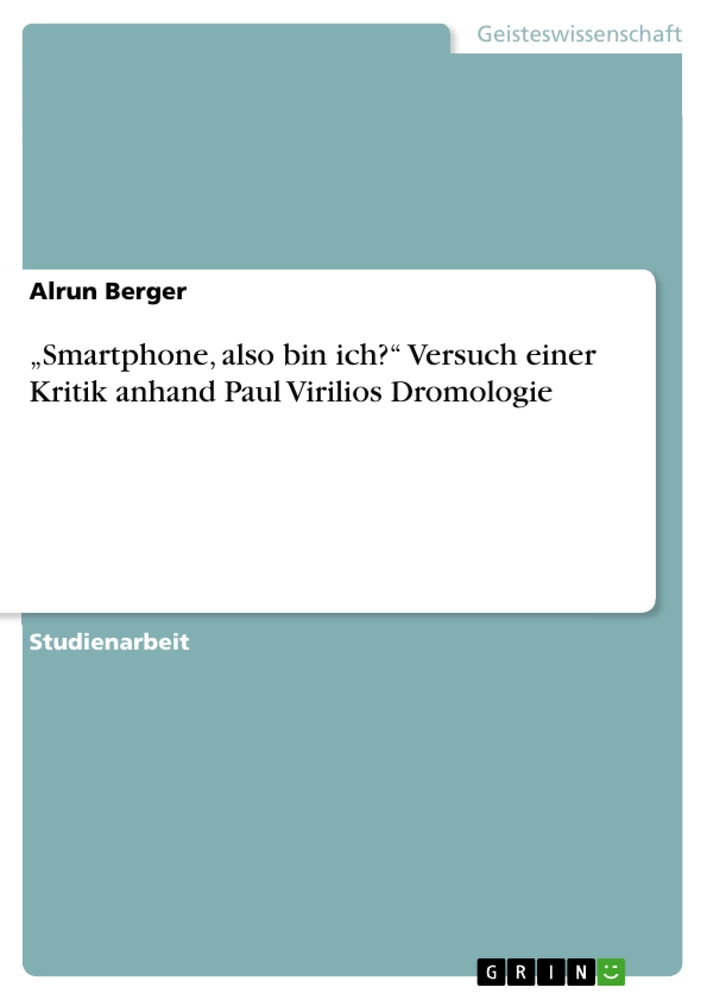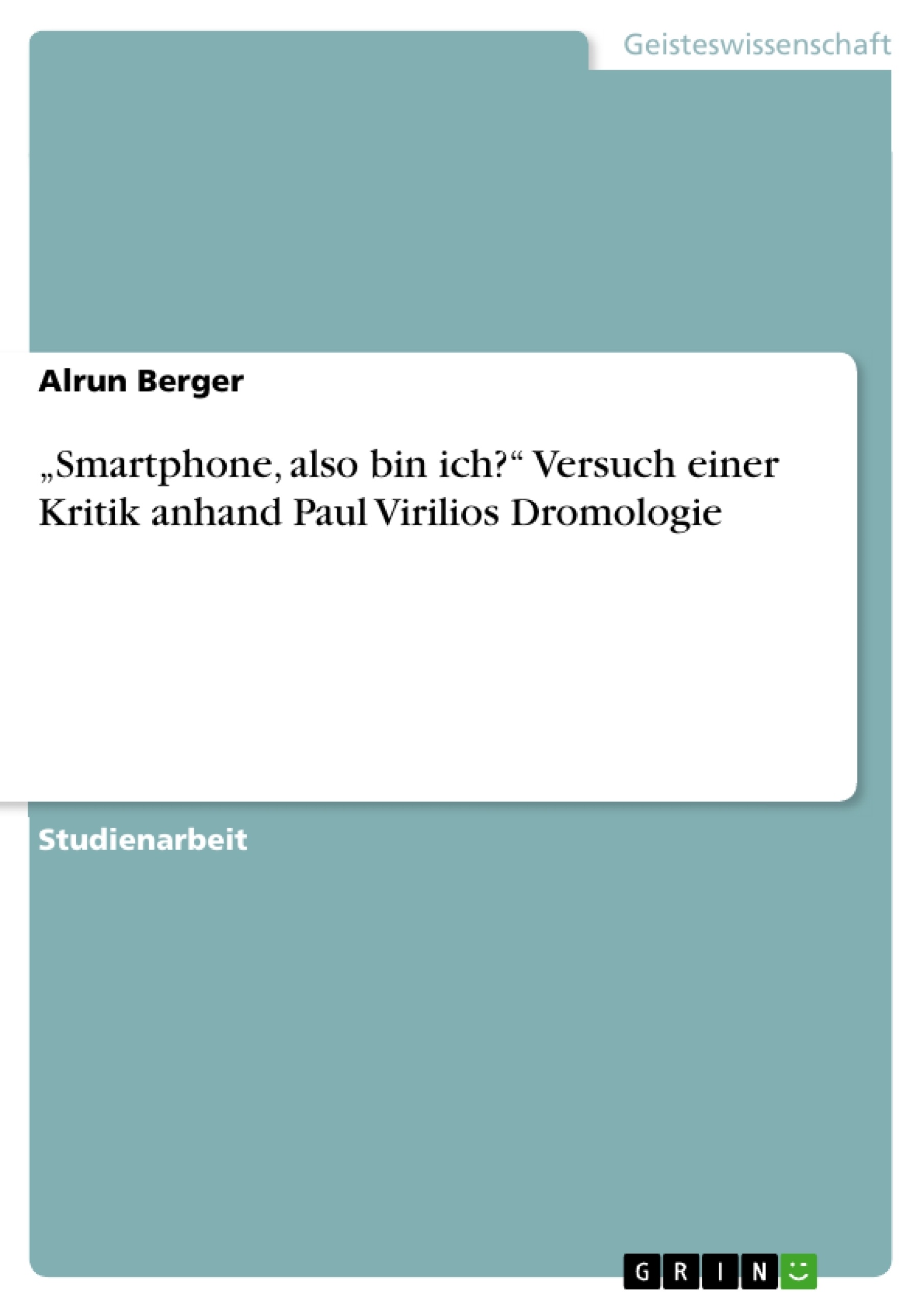Tatsächlich scheint die Zeit im öffentlichen Bewusstsein zu einer kostbaren Ressource geworden zu sein, mit der effizient gewirtschaftet werden muss. So sind in den letzten 25 Jahren eine Vielzahl an populären und wissenschaftlichen Publikationen zum Thema „Zeit“ und „Beschleunigung“ veröffentlicht worden,2 ja sogar ganze Wissenschaftskongresse befassen sich mit diesen Themen. Allerdings beschränkt sich das rege Interesse keineswegs nur auf die Wissenschaftswelt. „Beschleunigung“ ist zum Medienthema schlechthin avanciert und damit zu einem Thema der Öffentlichkeit (Kirchmann 2004: 75). Neben den zahlreichen und allgegenwärtigen Spots und Slogans, die sich des Themenkomplexes zu Werbezwecken für ihr jeweiliges Produkt bedienen,3 reicht das Spektrum von Museumsinstallationen, Seminaren zum Zeitsparen, über eine Flut an sogenannten Zeitspar-Ratgebern4 bis hin zu Fernsehsendungen und kompletten Filmen zum Thema.5
[...]
2 Zu den zwei bekanntesten Publikation der letzten zehn Jahre zählen unter anderem: ROSA, Hartmut (2005): Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt a. M und BORSCHEID, Peter (2004): Tempo-Virus. Eine Kulturgeschichte der Beschleunigung, Frankfurt.
3 Man denke dabei beispielsweise allein schon an die verschiedenen Slogans wie „Ihre Stadt im Geschwindigkeitsrausch“ oder „surfen Sie am Tempolimit“ u.dgl.m.
4 Hier sei exemplarisch auf die zahlreichen Veröffentlichungen und Seminare von Herrn Lothar Seiwert alias dem „Zeitmanagement-Papst“ verwiesen (vgl. bspw. SEIWERT, Lothar J. (2001): Mehr Zeit für das Wesentliche. Besseres Zeitmanagement mit der SEIWERT-Methode, Landsberg. Noch passender zum Thema der vorliegenden Arbeit scheint allerdings DERS. (2009): 30 Minuten Zeitmanagement mit Blackberry, Offenbach).
5 Erst jüngst lief der Dokumentarfilm „SPEED. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Florian Opitz in den deutschen Programmkinos.
Inhalt
I. Einleitung
II. Paul Virilios Lehre von der Geschwindigkeit
II. A. Methodische Orientierung der Dromologie: Das Beispiel der Transportmittel
II. B. Die Automatisierung von Wahrnehmung
III. Das Beispiel Smartphone
III. A. Das Gerät
III. B. Die „virtuelle Nabelschnur“
IV. Schlussfolgerung und Ausblick
VI. Bibliographie