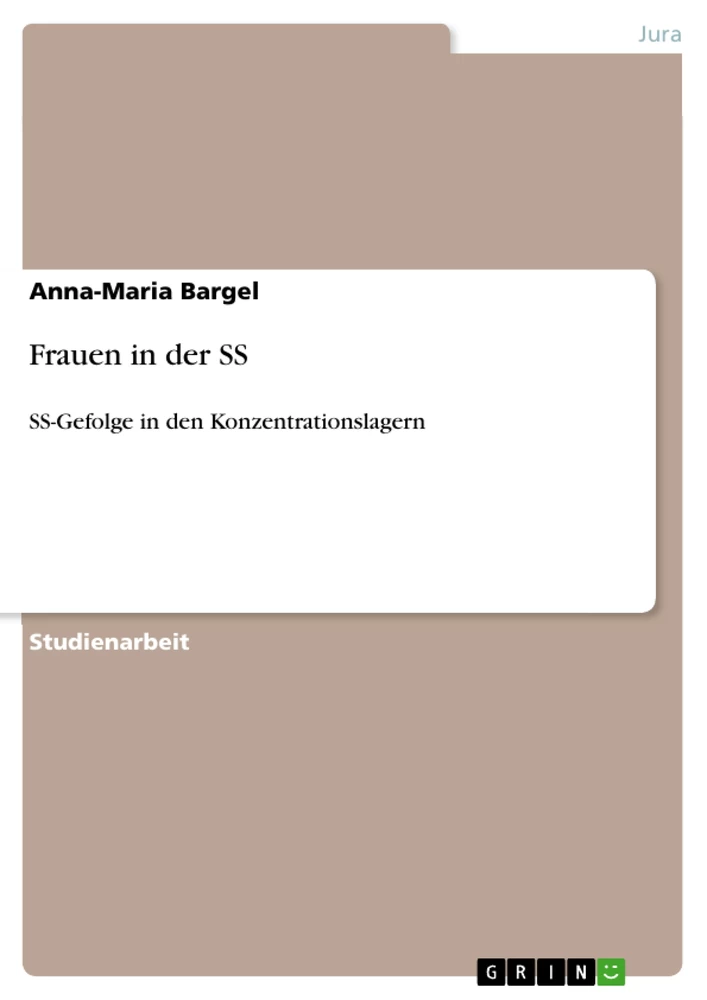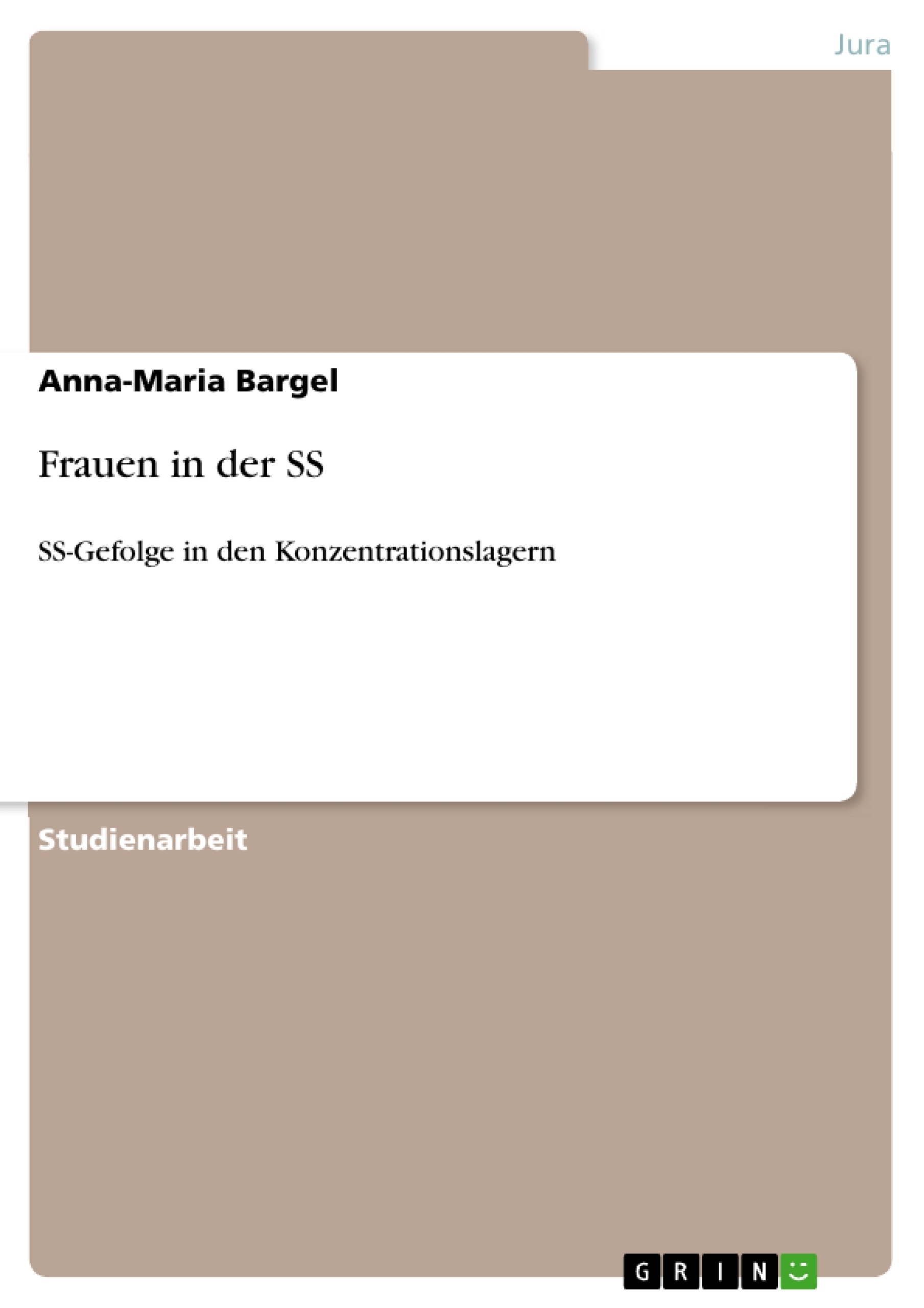Erst Anfang der 1990er Jahre beschäftigten sich erstmals Frauen wie Gudrun Schwarz mit der Aufarbeitung der Frauenrolle in der SS, dem sogenannten SS-Gefolge. Bis dahin fanden Frauen in der Betrachtung der Täterrolle in den Kon-zentrationslagern kaum Beachtung. In dieser Arbeit möchte ich mich den Frauen in den Konzentrationslagern von dieser Perspektive, der Nicht-Opferseite nähern und darstellen, wer diese Frauen waren, welche Aufgaben und Stellungen sie innerhalb der Lager hatten und was sie dazu bewegt hat, Teil dieses von Männern dominierten Systems zu werden. Im Speziellen widme ich mich den Aufseherinnen in den Konzentrationslagern, da sie den Großteil des SS-Gefolges ausmachten, durch ihre Tätigkeit im direkten Kontakt zu den Häftlingen standen und die Rolle der Frau als Täterin am besten verdeutlichen.
Inhaltsübersicht:
1 Ziel der Arbeit
2 Frauenkonzentrationslager ab 1939
3 Das weibliche SS-Gefolge
4 SS-Aufseherinnen
4.1 Erfordernis und Aufgabenfelder
4.2 Anzahl der Aufseherinnen
4.3 Die Rekrutierung
4.3.1 Freiwillige Meldung
4.3.1.1 Gründe für freiwillige Meldungen
4.3.2 Anwerbung
4.3.3 Dienstverpflichtung
4.4 Auswahlkriterien
4.5 Die Ausbildung zur SS-Aufseherin
4.6 Ansehen
4.7 Karrierechancen
4.8 Befugnisse
4.9 Dienstauffassung und Motivation
4.10 Das Leben der SS-Aufseherinnen
5 Gerichtsverfahren und Urteile
5.1 Die britischen Ravensbrück-Prozesse
5.2 Der Bergen-Belsen-Auschwitz-Prozess
6 Résumé
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis